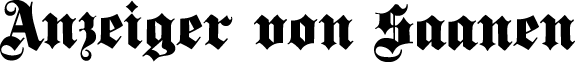Bach monumental rekonstruiert
17.07.2023 , Saanen, Konzert, Musik, KulturMit keinem geringeren als dem letzten, monumentalen Werk von Johann Sebastian Bach wurde das diesjährige Gstaad Menuhin Festivatival eröffnet. Und nicht nur das.
Ein Stück von Weltbedeutung
Die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach ist eine der bedeutendsten geistlichen Kompositionen. Es handelt sich um Bachs letztes grosses Vokalwerk und seine einzige Komposition, der das vollständige Ordinarium des lateinischen Messetextes zugrunde liegt: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Das Manuskript von 1748/1749 gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.
Wie schafft man ein authentisch barockes Klangerlebnis?
Schon beim blossen Betrachten des Orchesters wurden sich die Zuschauenden der Besonderheit der Aufführung bewusst: Bei den Instrumenten handelte es sich um Barockinstrumente – teils originale, teils nachgebaute.
Da sah man etwa ein mehrfach geschwungenes Naturhorn oder eine Barocktrompete, beide Blasinstrumente ganz ohne Klappen oder Ventile, bei denen die Künstler Naturtöne allein durch verschiedene Lippenspannung hervorbringen. Anstatt der gängigen Querflöte spielten die Musiker die barocke Traversflöte aus Holz. Auch die Streicher kamen ohne die heutigen technischen Hilfsmittel aus: Sie spielten ohne Kinn- oder Schulterstütze auf Darmsaiten, die einen Halbton tiefer gestimmt waren. Gestimmt übrigens ganz ohne die Hilfe von Feinstimmern. Eine Truhenorgel, Bass und Cello bildeten das durchgängige Continuo, das den typischen barocken Grundcharakter vorgab.
Zurück zur Bach’schen Aufführungspraxis
Die Gaechinger Cantorey aus Stuttgart wird seit 2013 von Hans-Christoph Rademann geleitet. Sie besteht aus einem Chor sowie einem Barockorchester. Die historisierende Schreibweise «Cantorey» verkörpert Rademanns Klangdenken: Er möchte den damaligen Aufführungspraktiken so nahe wie möglich kommen. Was genau im Sinne des künstlerischen Leiters des Gstaad Menuhin Festivals, Christoph Müller, ist: «Dies ist eine Abkehr von der Bachtradition des 20. Jahrhunderts. Damals waren das Aufführungen mit riesigen Chören mit bis zu 70 Sängern. Erst in den letzten 20 bis 30 Jahren geht die Tendenz zurück zum Ursprung, wie es von Bach angedacht war.» Sprich: mit kleinerem Chor, mit Solisten und einem überschaubaren Orchester mit Originalinstrumenten. Mit dieser Rekonstruktion der Uraufführungssituation lagen Christoph Müller und Hans-Christoph Rademann ästhetisch also ganz auf einer Wellenlänge.
Mit Pauken und Trompeten
Gut zwei Stunden lang ohne Unterbrechung dauerte die Aufführung. Das mag dem einen oder anderen Bach-ungewohnten Ohr im Vorfeld lange vorgekommen sein. Doch die Abwechslung zwischen Gesamtchor bzw. Gesamtorchester einerseits und den Arien in Verbindung mit den Soli der einzelnen historischen Instrumente andererseits faszinierte. Und nicht zuletzt zog die Geschichte, die da erzählt wurde, die Zuschauenden in ihren Bann. Da trugen etwa im Credo die Sopranistin Miriam Feuersinger mit dem Countertenor Alex Potter einen kanongleichen Gesang vor mit schnell wechselnden Einsätzen zwischen den beiden Solisten und dem Orchester – bravourös geleitet von Dirigent Hans-Christoph Rademann. Der – wohl gemerkt – das gesamte Werk leitete, ohne eine Partitur vor sich liegen zu haben. Gleich darauf setzt der Gesamtchor wieder ein, um von der Kreuzigung durch Pontius Pilatus zu erzählen, dezent begleitet nur von einzelnen Instrumenten in filigranen Begleitakkorden – leise, melancholisch, ein wenig dramatisch. Worauf in einem unerwarteten Kontrast wieder das Gesamtorchester und der Gesamtchor fast ohrenbetäubend gemeinschaftlich einsetzt, um von der Auferstehung zu berichten. Fröhlich, kraftvoll – und im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten.
Was ist Demut?
Mit einer inspirierenden Rede eröffnete Pfarrer Bruno Bader den Konzertabend. Er nahm Bezug auf das diesjährige Festivalmotto «Demut». Kurz ging er auf die schwierige Geschichte der ursprünglich evangelischen Tugend ein: «Demut hatte vor allem zu tun mit niedergeschlagenen Augen und gebeugten Knien» und diente somit als Mittel zur Zähmung – besonders für das weibliche Geschlecht. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heute ist die Demut laut Bader eher eine empathische Tugend: Sie geht vom Gegenüber aus. «Sie weiss: Wer andere klein macht, wird selbst nicht grösser.» Demut sei eine Haltung, die für die Kleinen und Geringen Verantwortung übernimmt. Und die auch einen Sinn für Vergänglichkeit hat, denn der Demütige weiss: «Es gibt welche, die vor mir waren und es wird welche geben, die nach mir kommen.» Wer dies beherzige, werde niemals abheben, sondern stets auf dem Boden bleiben, so Bader.
Demütig vor grandioser Musik und Umsetzung
Die beeindruckende Leistung der Künstler von Weltrang hallte nach und liess auch den künstlerischen Leiter Christoph Müller nach der Aufführung fast sprachlos und auch in gewisser Weise demütig zurück: «Ich bin berührt und beeindruckt.» Das eben Erlebte habe ihn bestärkt, das Richtige getan zu haben, «nämlich zum Festivalanfang ein so monumentales Stück zur Aufführung zu bringen.» Doch die Auswahl alleine reicht nicht. Das Stück musste natürlich auch entsprechend einmalig interpretiert werden. Als Rekonstruktion der barocken Uraufführung mit einer handverlesenen, kleineren Gruppe von Musikern und Sängern. Passend auch zum Raum der Kirche, wie Müller ergänzt. «Bei uns zählt Qualität und Exzellenz. Das haben wir heute erreicht.» Und zeigt sich bei allem Stolz auf den gelungenen Festivalauftakt doch auch demütig: «Wir sollten uns eine Bescheidenheit bewahren, denn es gibt etwas über uns, was wir nicht in unseren Händen haben. Das merkt man bei solch einer grandiosen Musik.»
Sedna gegen Natturalik oder das Spiel mit dem Klima
Beim Apéro vor dem Konzert konnte das interessierte Publikum bereits die Ausstellung «Spiel mit dem Klima» betrachten, die passend zum diesjährigen Konzertzyklus «Music for the Planet» errichtet wurde. Martha und Peter Cerny, die seit etwa 30 Jahren Inuitkunst sammeln und sich für Völker am Polarkreis engagieren, hatten die Exponate aus ihrem Museum in Bern mitgebracht.
Dabei stehen sich auf einem Schachbrett die Meeresgöttin Sedna mit ihrer Meerestierschar und der Steinadler Natturalik, Herrscher über die Luft und die Erde, mit seinen eigenen Geschöpfen gegenüber. Die Szene stellt ein Spielen mit dem Klima dar. «Man weiss nicht: Arbeiten sie miteinander oder gegeneinander?», erklärt Peter Cerny die Szene. «Die wichtigste Person ist gleichwohl der Besucher. Es liegt an ihm, etwas zu machen, damit der Klimawandel gestoppt wird.»
Im Rahmen des Konzertzyklus «Music for the Planet» hat Patricia Kopatchinskaja passend zum Hauptexponat das Auftragswerk «Sedna» komponiert, das am 10. August uraufgeführt wird.