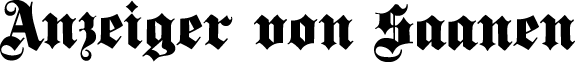Klänge aus dem Exil – Heimspiel von Khatia Buniatishvili
12.08.2025 KulturDem Publikum des Menuhin Festivals braucht die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete, international auftretende, in Batumi, Georgien, geborene Pianistin Khatia Buniatishvili nicht vorgestellt zu werden. Sie ist hier von früheren, sehr erfolgreichen Auftritten bestens bekannt. Sie ...
Dem Publikum des Menuhin Festivals braucht die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete, international auftretende, in Batumi, Georgien, geborene Pianistin Khatia Buniatishvili nicht vorgestellt zu werden. Sie ist hier von früheren, sehr erfolgreichen Auftritten bestens bekannt. Sie zog vor zwei Jahren von Paris in die Nähe von Montreux, ihr Auftritt vom letzten Sonntag im Festivalzelt kann somit als Heimspiel bezeichnet werden.
HANSUELI GAMMETER
Sie wählte für den Sonntagabend ein eher volkstümliches Programm, dies in dem Sinne, dass die Stücke von Schubert, Chopin, Mozart und Liszt jeder Klassikliebhaberin, jedem Klassikliebhaber bestens vertraut sind. Es gibt viele Einspielungen dieser Stücke und die Erwartungen an die Interpretin waren entsprechend hoch. Eine Künstlerin vom Range einer Buniatishvili braucht sich in dieser Hinsicht keine Sorgen zu machen und sie vermochte, dies sei vorweggenommen, das Publikum denn auch vorbehaltlos zu begeistern. Das Programm bezog seine Spannung aus dem Wechsel von Hausmusik, d.h. von Musik, die im familiären Kreis gespielt wird, und den virtuosen Stücken Chopins und Liszts für den Konzertsaal.
Migration
Die diesjährige Ausgabe des Festivals ist dem Thema Migration gewidmet. Franz Schubert kann im damaligen Wien, dem Zentrum des metternichschen Polizeistaats, mit Fug und Recht als Fremdling bezeichnet werden. Ein Fremdling war er bereits der Abstammung nach. Er wurde zwar in Wien geboren, sein Vater war aus Nordmähren nach Wien gekommen. Der Komponist stand unter polizeilicher Aufsicht und wurde aufs Polizeirevier zum Verhör mitgenommen, weil er in liberalen Kreisen verkehrte. Er arbeitete ausserhalb des offiziellen Musikbetriebs, ohne je mit bezahlten Aufträgen zu rechnen, und war zu keinerlei künstlerischen Konzessionen zu bewegen.
Demgegenüber war Chopin ein «echter» Emigrant. Er verliess seine polnische Heimat und ging ins Exil nach Paris, wo sich nach dem gescheiterten Novemberaufstand von 1830/31 viele polnische Emigranten niederliessen.
Liszt seinerseits war ein Emigrant der besonderen Art. Seine Liaison mit der verheirateten Gräfin Marie d’Agoult führte in Paris zu einem Skandal, und so verabschiedete sich das Liebespaar ins Exil. Es begannen die «Jahre der Pilgerschaft», die erste Station war Genf.
Schubert und Mozart für den Hausgebrauch
Schubert hat am Ende seines kurzen Lebens die beiden vierteiligen Zyklen der Impromptus geschrieben. Der damals in Mode gekommene Name hat die Bedeutung eines Stegreifstücks, einer Improvisation. «Die beiden ersten Stücke werden im Dezember (1827) bei Thomas Haslinger veröffentlicht. Sie richten sich an ein Amateurpublikum, doch dem erbärmlichen kommerziellen Resultat nach zu schliessen, ist dieses nicht empfänglich für ihren Charme», heisst es dazu im Programmheft.
An erster und dritter Stelle stehen zwei längere, lyrische Stücke, Ausdruck eines leicht melancholischen Lebensgefühls. Ihnen folgen zwei eher nach aussen gerichtete kunstvoll-elegante Salonstücke. Die Frage, ob es möglich sei, diese für das häusliche Musizieren geschriebenen Stücke in einem grossen Zelt vorzutragen, war rasch beantwortet. Auch in den leisesten Passagen hörte man jede von der Pianistin gestaltete Nuance, als sässe man im Sessel neben dem Klavier und nicht im Festzelt.
Die heute als «Sonata facile» bekannte Klaviersonate zeigt in ihrer einfachen, aber äusserst kunstvollen Gestaltung erst auf den zweiten Blick, dass es sich um ein Spätwerk des Meisters handelt. Mozart selber bezeichnete sie als «kleine Klaviersonate für Anfänger». Mutmasslich hoffte er, durch den Verkauf von Werken für Anfänger die nötigen Einnahmen zu erzielen, da er zu dieser Zeit knapp bei Kasse war. Unter den Händen der Pianistin war diese im Unterricht oft malträtierte Sonate kaum wiederzuerkennen. Sie bezauberte die Sinne wie eine zarte, köstliche Frühlingsbrise.
Virtuosität bei Chopin und Liszt
Der dritte Satz der Sonate, der berühmte Trauermarsch, lag bereits vor, als Chopin die übrigen drei Sätze komponierte. Man vermutet, dass er diesen Marsch im Gedenken an den Jahrestag des bereits erwähnten Warschauer Aufstands schrieb. Dem Marsch gehen zwei leidenschaftliche, düster gestimmte Sätze voraus. Die Pianistin wählte für diese Sätze ein eher rasches Tempo. Die stürmische Dynamik der beiden Sätze findet vorübergehend Ruhe in der kantablen Melodie des Trios des zweiten Satzes. Der dem Trauermarsch folgende vierte Satz ist ein Finale, wie es keiner vor Chopin geschrieben hat. Ein Spuk in Oktaven-Triolen, ohne Thema, ohne greifbare Gestalt, ein Vorbote des musikalischen Impressionismus.
Die Pianistin blieb den horrenden technischen und musikalischen Anforderungen dieser Musik nichts schuldig: Sie gestaltete dieses monumentale Stück trotz der Verschiedenheit der einzelnen Teile als überzeugende Einheit. Inspiration für die vier Balladen fand Chopin bei den Gedichten seines Landmanns Adam Mickiewics, der ebenfalls in Paris im Exil weilte. Die Stücke zeigen den Charakter einer dramatischen Erzählung, sie finden Erfüllung in einem gewaltigen Höhepunkt. Die vierte Ballade ist ein Spätwerk des Meisters, entsprechend raffiniert sind Aufbau und Harmonie. Die Pianistin verstand es meisterhaft, das Rhapsodische mit dem Dramatischen zu verbinden.
Beim «Mephisto-Walzer» von Liszt entfesselte die Pianistin noch einmal die ganze Breite ihres stupenden Könnens. Die Zugabe, ein Stück von Bach, holte das Publikum aus dem Fegefeuer Mephistos zurück und entliess es in den milden Sommerabend.