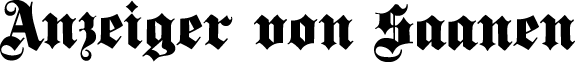Giuseppe Verdis «Totenmesse»
02.09.2025 KulturWie passend steht der Titel über dem Konzertprogramm des vergangenen Samstags: «The way to freedom» – der Weg in die Freiheit, der Wunsch so vieler Unterdrückter in unserer heutigen Welt. Verdis Musik drückt denn auch alle möglichen Gefühle aus, ...
Wie passend steht der Titel über dem Konzertprogramm des vergangenen Samstags: «The way to freedom» – der Weg in die Freiheit, der Wunsch so vieler Unterdrückter in unserer heutigen Welt. Verdis Musik drückt denn auch alle möglichen Gefühle aus, die emotional aufschreienden, aber auch die still-leidenden.
KLAUS BURKHALTER
Sicher fragten sich viele Gäste im Publikum, wie wohl Verdi als Kirchenmusiker sei, hatten doch sicher fast alle die Klänge einer «Nabucco»-, «Aida»- oder «Traviata»-Oper im Gedächtnis. Beim Aufmarsch des riesigen Orchesters und des grossen Chores merkte jedermann/-frau staunend, dass wohl ein gewaltiges Werk bevorsteht: Die Bühne war bis in die hinterste Ecke besetzt.
Entstehung des Werkes
Giuseppe Verdi war, obgleich katholisch erzogen, kein besonders religiöser Mensch, doch der Text der «Totenmesse» musste ihn angesprochen haben, gewisse Teile in besonderem Masse. Er hatte in seinem Leben viele traurige Momente erlebt, bei den Todesfällen seiner Kinder und seiner Ehefrau, seines Freundes Rossini und schliesslich des tief verehrten Dichters Alessandro Manzoni, der sich stark für die nationale Einheit Italiens eingesetzt hatte. Verdi brachte es nicht übers Herz, an dessen Begräbnis teilzunehmen. Dafür offerierte er der Stadt Mailand eine Komposition, die ein Jahr nach Manzonis Tod aufgeführt werden sollte. Diese erfolgte 1874 und hatte einen gewaltigen Erfolg. Sofort wurde die Messe oftmals in der Scala und auf allen Bühnen der grossen Opernhäuser weltweit aufgeführt. Das Werk gehört heute zu den beliebtesten, aber schwierigsten Beiträgen der Gattung «Totenmesse». Auch wenn Verdi in seinem Requiem einen – verglichen mit seinen Opern – anderen Ton anschlägt, verleugnet er doch niemals seine persönliche, in der Oper gereifte Handschrift.
Inhaltliches
Verdi revidierte das «Libera me», das er 1868 für eine Rossini-Messe geschrieben hatte (sie gelangte nie zur Aufführung), doch trug er schon früher kompositorische Ideen für ein vollständiges Requiem im Kopf. Es geht um die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Tod: «Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?»
Das Werk beginnt, kaum hörbar, aus der Stille. Verdi hatte ermahnt, dass die Messe nicht wie eine Oper gesungen werden dürfe, abgesehen von einigen Stellen, in denen sich der Komponist selbst nicht daran hielt, wie beispielsweise beim ersten Tenoreinsatz im «Kyrie». Mit gewaltigen Tutti-Schlägen wird das Publikum im «Dies irae» aus der Stille gerissen – ein wahrer Gewittersturm, hart, unerbittlich und wuchtig. Das Festivalzelt droht zu zerspringen! In der «Sequenz» verglühen die Motive dem Text gemäss zu Asche. Was für Gegensätze ertönen: strahlende Klangpracht, melodisch berückende Stellen, aber auch stockende, «verstörte» Leere wie beispielsweise das «Mors» des Bassisten. Das «Offertorium» wird nur vom Solist:innenquartett gesungen, begleitet von feinen, oft fast hauchenden Orchesterklängen. Doch auch hier: Scharfe Trompetensignale reissen alle aus der Ruhe. Die Sanctus-Rufe führen in eine vor Lebendigkeit sprühende Doppelfuge – ein polyfones Feuerwerk, welches im «Agnus Dei» mit schlichten, fast minimalistischen Variationen abgelöst wird. Das «Lux aeterna» ist wiederum den Solist:innen vorbehalten, sogar mit A-cappella-Passagen, bevor das «Libera me» den Ruf nach Freiheit und Erlösung ausdrückt. Es ist an Wucht kaum zu übertreffen, geht unter die Haut und lässt das Zelt wieder erbeben. Zuhörende mit empfindlichem Gehör haben zu leiden… Doch der Schluss ist ein leiser, geheimnisvoller Akkord – wird die Bitte nach Befreiung erfüllt oder nicht?
Grossartige Interpretationen
Ein hervorragendes Solist:innenquartett, ein ebensolcher Chor und das riesige Orchester wurden vom Dirigenten Gianandrea Noseda gefühlvoll und präzis geführt. Er lebte das Werk, gab seine Ideen, auch ohne Taktstock, mit Händen, Fingern, Gesichtsausdruck und Körperbewegungen an die Musizierenden weiter – ein wahrer Meister seiner Kunst. Und alle Beteiligten standen ihm nicht nach. Sie strotzten vor Intensität und Engagement. Der Chor der Oper Zürich stellte sein Können in allen Bereichen unter Beweis, in komplizierten A-cappella-Passagen, in den gewaltigen Tuttis, in denen er die Angst der Menschheit zum Ausdruck brachte, aber auch in den geflüsterten oder gemurmelten Partien. Das Orchester der Oper Zürich packte in allen Registern, seinem Chef folgend, mit seinem klangintensiven Spiel zu, engagiert und sehr differenziert in allen Phasen, sowohl bei den Streichern, wie auch beim grossen Bläserregister und den kraftvollen Pauken.
Das hochkarätige Solist:innenquartett wirkte als Einheit. Alle vier werden enorm gefordert. Sie alle gehören zu der absoluten Spitzenklasse, stehen auf allen Bühnen der Welt und kennen das Verdi-Requiem von früheren Interpretationen her bestens. Die Sopranistin Eleonora Buratto sang mit schlagkräftiger Intensität. Mühelos, mit unfehlbarer Intonationssicherheit erstieg sie ihre Höhen, als Glanzpunkt im «Libera me» mit der Oberstimme zum Chor bis hin zum gekonnt und klangschönen hohen b! Elina Garanca gestaltete ihre fesselnden Passagen mit ihrem grossen Stimmvolumen in herrlich durchklingenden Mittellagen – warm, edel, einfühlsam, oft auch mit gewaltig-kräftigem Ausdruck. Der Tenor Piero Pretti hatte seine Partie kurzfristig vom erkrankten Joseph Calleja übernommen. Er fügte sich herrlich ins Ensemble ein und begeisterte mit seiner intensiven Belcanto-Stimme. Auch der Bassist Roberto Tagliavini passte mit seiner warmen, auch gefühlvoll-mächtigen Stimme bestens ins Quartett.
Atemlose Stille herrschte nach den letzten Tönen. Sie zeugte von der Ergriffenheit aller Beteiligten und des Publikums, bevor die berechtigten Begeisterungsstürme mit Standing Ovations und Bravi-Rufen losbrachen.
Es war ein würdiger Abschluss der diesjährigen Zeltkonzerte.