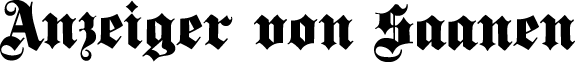Der Pianist im Einklang mit seinem Instrument
11.08.2025 KulturBesonders auffallend beim Klavierspiel von Francesco Piemontesi ist, wie er verinnerlicht, mit höchst möglicher Klangoptimierung Kompositionen interpretiert und charakterisiert. Er trat im Rahmen des Gstaad Menuhin Festivals schon einige Male auf und wird am nächsten ...
Besonders auffallend beim Klavierspiel von Francesco Piemontesi ist, wie er verinnerlicht, mit höchst möglicher Klangoptimierung Kompositionen interpretiert und charakterisiert. Er trat im Rahmen des Gstaad Menuhin Festivals schon einige Male auf und wird am nächsten Freitag in der Kirche Saanen mit einem Rezital aufwarten.
LOTTE BRENNER
Die Klangoptimierung ist eine recht schwierige und aufwendige Sache, die der Pianist oder die Pianistin allein nicht bewältigen kann. Dazu braucht es nämlich nebst einem erstklassigen Flügel auch einen erstklassigen Klaviertechniker, der diesem Instrument die Seele einhaucht. Dies mag romantisch tönen, aber Tatsache ist, dass mit einigen Eingriffen in die Klaviertechnik Töne verändert (weicher, härter, heller, dunkler...) werden können. Ist das Klavier einmal eingestellt, muss der Pianist mit der vorgegebenen Mechanik arbeiten.
Für die Klanggestaltung spielen viele Faktoren eine Rolle. Am Klangkörper selbst ist nichts veränderbar. Welches Holz dafür verwendet und wie es getrocknet wurde, ist die Voraussetzung für den Bau eines Klaviers. Aber in der Mechanik selbst gibt es einige Toleranzen in der Regulierung, beispielsweise bei der Gewichtung einzelner Bauteile. Hier kommt schon mal die Physik ins Spiel: das Bewegen der Teile in der Masse («Massenträgheit»), was je nachdem den Widerstand bestimmt. Dann die Übersetzungsverhältnisse (kleiner oder grösser). Die müssten auf das Gewicht des Hammerkopfs abgestimmt sein. Sind diese Übersetzungsverhältnisse in der Mechanik nicht optimal (vergleichbar mit dem Getriebe im Auto), bringt man die gewünschte Klangdynamik nicht hin. Hier dauert die optimale Anpassung durch den Klaviertechniker allerdings rund zehn Tage.
Dies ist nur ein winzig kleiner Einblick in ein immens grosses Berufsfeld des Klavierbaus. Neben der Mechanik gibt es nämlich noch sehr viele akustische Probleme zu bewältigen, wie das Mitschwingen der Obertöne, Tonveränderungen auf Distanz – Dinge, die beim Stimmen des Flügels berücksichtigt werden müssen.
Wie also geht ein Pianist wie Piemontesi, dem der Klang so wichtig ist, mit all diesen Möglichkeiten einer klanglichen Optimierung um? Er war bereit, dem «Anzeiger von Saanen» einige Fragen zu beantworten.
Francesco Piemontesi, das Publikum bewundert stets die Virtuosität, die schnelle Tastenakrobatik. Das ist heute eigentlich die Voraussetzung für ein anspruchsvolles Klavierkonzert oder -Rezital. Diese virtuose Technik beherrschen Sie zweifellos. Doch ist es bei Ihnen etwas ganz anderes, was die Zuhörerschaft in den Bann zieht: eben der Klang – die Klangfarbe, die Nachhaltigkeit.
Piemontesi: In den ersten Studienjahren standen Virtuosität und Präzision im Vordergrund. Doch schon bald suchte ich nach musikalischen Verfeinerungen und somit auch Möglichkeiten, die Farbe zu verändern.
Als Student des «Conservatorio della Svizzera italiana» (heute Hochschule für Musik) in Lugano waren Sie in der Steinway-Fabrik in Hamburg bei der Auswahl eines Flügels für die Schule massgeblich dabei. Heute noch ist dieses Instrument das Prunkstück der Musikschule. Nach welchen Kriterien gingen Sie damals vor?
Wichtig bei der Auswahl eines Flügels ist zu wissen, in welchen Raum er kommt. Wir haben das entsprechende Instrument bald einmal herausgefunden, das in der Aula des «Conservatorio» optimal klingt. Anders als im flachen und kleinen Raum des Showrooms in Hamburg muss ein Flügel sich in einem grösseren Raum entfalten. In einem grossen Saal oder sogar im Freien, wie beispielsweise auf der Waldbühne, braucht es ein kräftiges Instrument, das auch oben leuchtend singt.
Bald darauf durfte ich für das «Orchestre de la Suisse Romande» nochmals ein Instrument aussuchen.
Etliche Pianisten bevorzugen den Bösendorfer Flügel. Sie spielen meistens auf Steinway.
Der Bösendorfer verfügt über weiche Basstöne (schmunzelnd: «fast wie Schoggi-Mousse»), die zum Beispiel in Schubert-Kompositionen wunderschön zur Geltung kommen. Am Steinway-Flügel begeistern mich immer wieder die hellen, klaren Diskanttöne.
Haben Sie auch schon ein Instrument zurückgewiesen?
Ja, das kam schon vor. Und dann beschafften die Organisatoren vor Konzertbeginn noch einen annehmbaren Ersatzflügel. Aber in den letzten Jahren wurden mir immer gute Instrumente zur Verfügung gestellt, besonders hier in Gstaad, wo der hervorragende Klaviertechniker Urs Bachmann in filigraner Arbeit höchste Klangqualität hervorbringt. Er hat schon mehrere Instrumente für Konzertaufnahmen von mir betreut. Da geht es um eine optimale Intonation, zum Beispiel, indem er den Hammerfilz verändert oder/und Bleistücke in die Tastatur einbaut, deren Gewicht dann die Lage bestimmt. Schwerere Gewichte erzeugen eine tiefere Tonlage.
Wie bringen Sie dem Klaviertechniker Ihre Klangvorstellung bei?
Das ist eine wichtige Aufgabe, die sich gleich zu Beginn einer Zusammenarbeit stellt. Der Techniker muss verstehen, was der Pianist will. Ich höre ganz klar, was das Instrument hergibt und versuche dann, meine Klangvorstellung zu formulieren. Es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Sprache finden, vom Gleichen sprechen. Dies braucht Zeit und Vertrauen.
Ich ziehe es vor, Intonation und Einspielung einen Tag vor dem Konzert vorzunehmen. Ich vertraue auf meine innere Vorstellung und vor allem stelle ich mir vor, wie es im Saal ankommt. Manchmal stelle ich ein Aufnahmegerät in den Raum.
Nun haben wir von Massnahmen gesprochen, die an einem Instrument vor einem Konzert vorgenommen werden können. Doch gibt es qualitative Veränderungen, für welche der Klaviertechniker längere Zeit braucht. Die Instrumente werden ab Fabrik unbearbeitet ausgeliefert. Meistens werden die Flügel erst bei einem grossen Service optimiert. Es kann also sein, dass Ihnen ein ganz tolles Instrument angeboten wird, das jedoch Ihren klanglichen Ansprüchen nicht genügt.
Genau deshalb will ich immer wissen, wo der Flügel vorher stand und wer ihn gewartet hat.
Das Thema Klangoptimierung ist spannend, unerschöpflich und sowohl philosophisch als auch wissenschaftlich hoch interessant. Je grösser die Auseinandersetzung damit, desto sensibler wird der Konzertgenuss. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und weiterhin viel Erfolg.
CHRISTOPH MÜLLER WIRD NACHFOLGER
Seit 2013 ist Francesco Piemontesi künstlerischer Leiter der «Settimane Musicali» in Ascona. Nachfolger wird der bisherige Intendant des Gstaad Menuhin Festivals, Christoph Müller.
Francesco Piemontesi: «Die ‹Settimane› ist der Ort, wo ich, damals mit der spanischen Pianistin Alicia de Larrocha, die Musik kennengelernt habe. Bereits 2011 wurde ich angefragt, ob ich die Leitung dieses Festivals übernehmen möchte, was ich dann auch gleich im Jahr 2012 an die Hand nahm.
Doch nun ist es Zeit, dieses Festival zu professionalisieren, vor allem, was die Organisationskultur anbelangt. Ich habe damals Christoph Müller als meinen Nachfolger vorgeschlagen und freue mich sehr, dass auch der Stiftungsrat ihn für bestens geeignet hielt. Ich kenne ihn schon lange, denn er wurde schon auf mich aufmerksam, als ich noch Student war.»
LOTTE BRENNER