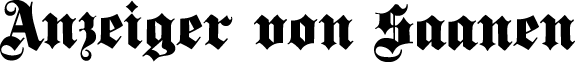«Das Netto-Null-Ziel braucht mehr Strom, als wir haben»
29.11.2024 SaanenAm BKW-Anlass in Saanen stellte sich die Konzernleitung den Fragen des Publikums. Und ausgerechnet als es ans Raclette am Apéro ging, fehlte der Strom. Allerdings nur für kurze Zeit und es war kein Stromausfall.
KEREM S. MAURER
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Die BKW kommt in Ihre Region» besuchte der Berner Energiekonzern, der zu 52,5 Prozent dem Kanton Bern gehört, am Montagabend Saanen. Es war das erste Mal, dass die BKW diese Veranstaltungsreihe durchführte. Nach Spiez, Ostermundigen und Wangen an der Aare war Saanen die vierte und letzte Station. Das Ziel dieser Veranstaltungen: Die BKW-Konzernleitung – vertreten durch Konzernleitungsmitglied Corinne Montandon, Leiterin BKW Power Grid – suchte den direkten Dialog mit der Bevölkerung. Der Anlass war sehr gut besucht.
Viele Projekte durch Einsprachen blockiert
Im ersten Teil nannte Corinne Montandon Zahlen und Fakten zur BKW. Bei den bereits umgesetzten Kraftwerken im Zusammenhang mit erneuerbarer Energie kam sie auf die Wasserkraftwerke in unserer Region zu sprechen. Jenes in Lauenen liefert seit 2014 jährlich rund drei Gigawattstunden und das neue im Turbach soll ab Sommer 2026 rund 7,3 Gigawattstunden pro Jahr produzieren. Die beiden Wasserkraftwerke im Simmental, Fermelbach und Laubegg, produzieren jährlich seit 2016 gemeinsam rund 23 Gigawattstunden. Doch es braucht deutlich mehr: «Wenn wir das Netto-Null-Ziel erreichen wollen, brauchen wir mehr Strom, als wir heute haben», sagte sie (siehe Kasten). Corinne Montandon bedauerte, dass viele Projekte zur Gewinnung von erneuerbarer Energie momentan durch Einsprachen blockiert sind.
Bedarf an Importstrom steigt
Corinne Montandon veranschaulichte, dass seit 2022 mehr Solarstrom ins BKW-Netz eingespeist werde als Wasserkraft. 2012 seien erst rund 1000 Solaranlagen in Betrieb gewesen, heute würden über 29’000 Anlagen unterhalten. 5800 davon seien allein im letzten Sommer in Betrieb genommen worden. Insgesamt sind laut der BKW im Jahr 2023 rund 7800 Anschlussgesuche für PV-Anlagen eingegangen. Corinne Montandon hielt fest: «PV-Anlagen helfen zwar bei der Energiewende, aber sie allein lösen das Problem leider nicht.» Stichwort: Winterstrom. Der Bedarf an Importstrom nehme zu. Übrigens: Das erste Solarkraftwerk ging laut BKW bereits 1992 ans Netz.
Nicht nur Lob für die BKW
Bei den anschliessenden Fragen ging es unter anderem um die «mickerige» Rückvergütung von «lächerlichen» 3,6 Rappen pro Kilowattstunde, wenn durch eigene PV-Anlagen Strom ins BKW-Netz eingespeist wird und man wunderte sich, dass die BKW Solarstrom als grauen Strom bezeichnet. Corinne Montandon erklärte den tiefen Preis mit dem Marktpreis (siehe Interview). Ein anderer Votant fand, es wäre sinnvoll, Dachflächen mit PV-Anlagen zu bestücken, statt Landschaften mit Panels zu verbauen. Dem hielt die BKW entgegen, dass die Leistungsspitze von Indachanlagen nachmittags um drei stattfinde, also dann, wenn wenig Strom gebraucht werde. Daher müsse jeweils viel Strom ins Netz eingespeist werden, wofür dieses (noch) nicht ausgelegt sei.
Eine andere Stimme aus dem Publikum äusserte den Wunsch, seinen selbst produzierten Strom statt einzuspeisen, den Nachbarn zu verkaufen. Dies ist laut BKW ab kommendem Jahr möglich. Dann können Solaranlagebetreiber ein Gesuch stellen, um die infrastrukturelle Machbarkeit in ihrer Umgebung zu prüfen. Ein weiterer Punkt war der Herkunftsnachweis, mit dem die BKW zusätzliche 3,5 Rappen pro Kilowattstunde bezahlt. Eine gute Sache, aber bürokratisch aufwendig, meinte jemand und fragte, ob diese Vergütung nicht einfach automatisch geschehen könne. Die BKW erklärte, dass dies juristisch nicht machbar sei, weil sie als Netzbetreiber ihren Kunden keine Hilfestellung bei sogenannten Marktgeschäften leisten dürfe.
Strompanne am Apéro
Am Apéro kam es im Zusammenhang mit dem Raclette zu einer Situation, die im Sinne der Veranstaltung so wohl nie hätte passieren dürfen: Dem Racletteofen der Cateringfirma ging der Strom aus, aber: «Es war kein Stromausfall!», beteuerte die Medienstelle der BKW auf Anfrage. Der Racletteofen sei defekt gewesen, worauf die Cateringfirma das Raclette in der Industrieküche zubereitet habe. Während dieser Umstellung habe es längere Wartezeiten von etwa zehn Minuten gegeben. Die BKW: «Wir danken für die Geduld und das Verständnis unserer Gäste.»
ANZAHL ANGESCHLOSSENE PV-ANLAGEN IN DER REGION
Saanenland: 376
Saanen 348, Lauenen 28
Simmental: 423
Boltigen 58, Zweisimmen 146, St. Stephan 51, Lenk 168
NETTO-NULL-ZIEL
Der Bundesrat hat im August 2019 als Reaktion auf den Sonderbericht des Weltklimarates (IPCC) über die Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius beschlossen, bis Mitte des Jahrhunderts eine ausgeglichene Treibhausgasbilanz anzustreben. Dieses Netto-Null-Ziel ist auch Gegenstand des Klima- und Innovationsgesetzes, dem die Stimmbevölkerung in der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023 mit rund 59 Prozent zugestimmt hat. Konkret heisst das: Die Schweiz soll ab 2050 nicht mehr Treibhausgase (die bekanntesten sind CO2, Methan und Lachgas) in die Atmosphäre ausstossen, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden. BAFU/kma
«Die BKW will über eine Milliarde in Schweizer Wasserkraft-, Wind- und Solaranlagen investieren»
Wir haben Corinne Montandon im Vorfeld der Veranstaltungsreihe einige Fragen gestellt. Das Interview wurde schriftlich geführt.
KEREM S. MAURER
Corinne Montandon, man hört oft, dass das Netz der BKW, sprich das Stromnetz allgemein in der Schweiz, an seinen Belastungsgrenzen läuft. Wie schätzen Sie die Auslastung des Netzes ein?
Corinne Montandon: Die Stromnetze in der Schweiz sind historisch gewachsen, auch jene der BKW. Heute können wir damit unsere Kundinnen und Kunden sicher und effizient mit Strom versorgen. Klar ist aber auch: Weil wir immer mehr Solarstrom produzieren, müssen wir die Stromnetze in der Schweiz verstärken und ausbauen. Dafür brauchen wir schnellere Bewilligungsverfahren. Wir brauchen aber auch intelligente Massnahmen, damit die Kosten nicht ins Unermessliche steigen. Das Peak-Shaving, also eine Einspeiselimitierung von Solaranlagen, ist hier eine wichtige Sofortmassnahme. Die BKW wird bis 2030 eine Milliarde Franken in ihr Stromnetz investieren.
Vor Kurzem wurde die alpine Solaranlage SolSarine von der Gemeindeversammlung bachab geschickt. Die Anlage SolSarine 2.0 hätte gemäss Initiativkomitee jährlich 50 Gigawattstunden Solarstrom produzieren sollen. Hätte das bestehende Netz diese Strommenge überhaupt fassen können?
Ja, das wäre möglich. Wir von der BKW standen im engen Austausch mit den Projektanten und haben eine Lösung gefunden. Wir hätten nur kleinere Netzverstärkungen und neue Anschlussleitungen erstellen müssen. Allerdings hätten wir dann weniger Kapazität im Netz gehabt für den Anschluss weiterer Gross- oder Kleinanlagen.
Wenn Private auf ihren Hausdächern Solarpanels installieren und ihren überschüssigen Strom ins BKW-Netz einspeisen, werden sie dafür kaum noch entschädigt. Die Entschädigung ist in den letzten Jahren stetig geschrumpft und liegt heute mit unter vier Rappen weit unter dem, was man für den Strombezug bezahlen muss. Warum ist es dermassen uninteressant, Solarstrom einzuspeisen?
Die BKW zahlt ihren Kundinnen und Kunden, die Solarstrom ins BKW-Netz einspeisen, den jeweiligen Marktpreis. Das ist jener Preis, den die BKW selbst erhält, wenn sie den eingespeisten Strom weiterverkauft. In der Energiekrise waren das über 40 Rappen pro Kilowattstunde. Die aktuelle Rückliefervergütung der BKW für das zweite und dritte Quartal 2024 beträgt 3,6 Rappen pro Kilowattstunde. Die BKW hat zudem die Vergütung der Herkunftsnachweise (HKN) per 1. Juli 2024 auf 3,5 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. Damit unterstützen wir die Energiewende, zu der sich die Schweizer Stimmbevölkerung am 9. Juni 2024 mit dem deutlichen Ja zum Stromgesetz bekannt hat. Der Tarif, den wir unseren Kundinnen und Kunden für den bezogenen Strom verrechnen, ist unter anderem deshalb höher, weil die BKW auch dann Strom liefert, wenn die Sonne nicht scheint.
Angenommen, die gesamte Fläche an Dächern, die von der Grösse her im Saanenland geeignet wären, würden Solarstrom produzieren und diesen einspeisen. Wäre dies von den Netzkapazitäten her überhaupt machbar?
Nein, das wäre nicht machbar. Allerdings ist das auch nicht notwendig. Um die Ziele des Stromgesetzes zu erreichen, reicht es, bis 2040 etwa 60 Prozent der geeigneten Dachflächen mit einer Solaranlage auszurüsten. Auch dafür müssen wir unser Verteilnetz massiv ausbauen.
Private, die Solarstrom produzieren, werden von der Politik kaum unterstützt. Warum werden solche Ambitionen in Zeiten des Klimawandels nicht mehr gefördert und worin besteht der Anreiz, Solarpanels zu montieren?
Die BKW hat letztes Jahr rund 5600 Solaranlagen an ihr Verteilnetz angeschlossen, das sind drei Mal so viele wie 2020. Offenbar ist es für viele Besitzerinnen und Besitzer eines Hauses durchaus interessant, eine Solaranlage zu installieren. Der wichtigste Anreiz besteht natürlich darin, den auf dem Dach produzierten Strom gleich selbst zu brauchen – oder den Strom im Rahmen eines ZEV den Nachbarn zu verkaufen. Mit dem Stromgesetz wird es ab 2026 schweizweit eine Mindestvergütung geben für den eingespeisten Strom, was die BKW unterstützt. Beides zusammen ermöglicht es den Besitzern von Solaranlagen, diese wirtschaftlich zu betreiben.
Ist es überhaupt machbar, den ganzen Schweizer Strombedarf durch erneuerbare Energiequellen abzudecken oder braucht es tatsächlich wieder neue AKWs?
Die Energiestrategie 2050 des Bundes zeigt einen Weg auf, um die Schweiz auch ohne neue Kernkraftwerke sicher und zuverlässig mit Strom zu versorgen. Und die Schweizerinnen und Schweizer haben diesen Weg mit dem Ja zum Stromgesetz am 9. Juni 2024 deutlich unterstützt. Dafür müssen wir aber schneller als bisher die erneuerbare Energieproduktion und die Verteilnetze in der Schweiz ausbauen können. Die BKW will über eine Milliarde Franken in den Bau von Schweizer Wasserkraft-, Wind- und Solaranlagen investieren. Viele dieser Projekte sind aber leider durch Einsprachen blockiert. Wenn es uns nicht gelingt, genügend Produktionsanlagen für erneuerbare Energie in der Schweiz zu bauen, kann langfristig auch ein neues KKW ein Thema werden. Der Bau und wirtschaftliche Betrieb eines neuen Kernkraftwerks brauchen aber einen breitabgestützten gesellschaftlichen Konsens, welcher über Jahrzehnte tragfähig ist.
Der Strombedarf ist in der Schweiz seit 2010 rückläufig. Warum spricht man in den Energiekonzernen dennoch immer wieder von drohenden Strommangellagen?
Die BKW geht – wie der Bund auch – davon aus, dass der Strombedarf in der Schweiz und in Europa mittelfristig steigen wird. Dafür verantwortlich sind zum einen die zunehmende Elektrifizierung in den Bereichen Mobilität, Prozesse und Wärme, zum anderen die neuen Stromverbraucher wie etwa Rechenzentren. Aber natürlich entwickeln wir auch Szenarien, in denen der Strombedarf europaweit weniger stark ansteigen wird als erwartet – um auch auf diese Möglichkeit vorbereitet zu sein.
Man munkelt, im Saanenland werde von grösseren Solaranlagen auf privaten Dächern abgeraten, weil die Netzkapazität die Strommenge nicht mehr aufnehmen könne. Ist das nicht ein grosser Widerspruch, auch hinsichtlich des Energierichtplans der Gemeinde Saanen?
Wir von der BKW raten niemandem in unserem Verteilnetzgebiet davon ab, eine Solaranlage zu errichten. Das dürften wir auch gar nicht. Denn als Verteilnetzbetreiberin haben wir eine gesetzliche Verpflichtung, alle Anlagen an unser Netz anzuschliessen.