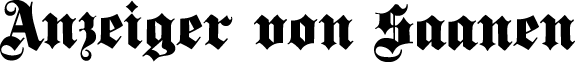«Zum Glück bin ich sitzen geblieben»
16.05.2024 PorträtRené Ryser ist seit gut zwölf Jahren Geschäftsführer der Molkerei Gstaad. Er hat damals ein schwieriges Erbe angetreten und hatte einige Herausforderungen zu meistern. Die Jahre seien extrem schnell vorbeigegangen, aber er erinnere sich an seinen ersten Tag, wie wenn ...
René Ryser ist seit gut zwölf Jahren Geschäftsführer der Molkerei Gstaad. Er hat damals ein schwieriges Erbe angetreten und hatte einige Herausforderungen zu meistern. Die Jahre seien extrem schnell vorbeigegangen, aber er erinnere sich an seinen ersten Tag, wie wenn es gestern gewesen wäre, erzählt er im Interview.
Anita Moser
René Ryser, seit gut zwölf Jahren sind Sie Geschäftsführer der Molkerei Gstaad. Wie haben Sie die Zeit in Erinnerung?
René Ryser: Die Jahre sind extrem schnell vorbeigegangen. Aber ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre, an meinen ersten Arbeitstag, als ich in Uetendorf morgens um 8 Uhr in den Zug stieg. Wenn ich damals gewusst hätte, was mich erwartet, wäre ich wahrscheinlich im Lerchenfeld wieder ausgestiegen. Aber zum Glück bin ich sitzen geblieben.
Und was wären rückblickend Gründe gewesen, um im Lerchenfeld wieder auszusteigen?
Die Molkerei Gstaad hatte in den Nullerjahren eine sehr bewegte Zeit. Und alles war noch relativ frisch. Es war nicht nur der Fall Reust, auch die Jahre danach wurde es mit den vielen personellen Wechseln in der Führungsetage nicht viel besser. Gegen aussen hat man das wahrscheinlich nicht so wahrgenommen. Im Fokus stand, auch medial, der Käseskandal. Der Anfang war wirklich hart.
Was war ausser dem schwierigen Erbe das bisher Prägendste?
Zwei Sachen. Einmal die Realisierung der neuen Käserei. An Auffahrt 2012 kamen der Präsident, der Landbesitzer und ich zum ersten Mal am ersten evaluierten Standort zusammengekommen. Aber bauen konnten wir erst am vierten von uns evaluierten Standort. Wir hatten davor ein Grundstück gekauft und wieder verkauft. Das Thema hat uns während acht Jahren permanent begleitet.
Gebaut hat die Genossenschaft schliesslich an der Lauenenstrasse. Hat sich der Standort bewährt?
Absolut. Im August 2020 haben wir angefangen zu käsen. Technisch ist die Anlage auf einem sehr guten Stand. Es gab nur sehr wenige Kinderkrankheiten.
Und die zweite prägende Sache?
Sehr einschneidend war der Listerienbefall im Jahr 2020. Andere Herausforderungen verursachen ein permanentes Grundrauschen, aber so etwas passiert von jetzt auf gleich. Ich rief den Präsidenten an und informierte ihn. Aber die Tragweite dieses Vorfalls war zu diesem Zeitpunkt noch niemandem bewusst.
Und wie hat der Genossenschaftspräsident auf Ihren Anruf reagiert?
(Lacht.) Die Antwort des Präsidenten lautete: «Du weisst sicher schon, was zu machen ist.» Oder anders gesagt: «Schau, dass das in Ordnung kommt.» Erfahrung hatten wir ja nicht – zum Glück. Aber so etwas ist wirklich keine Lappalie. Ich würde meinen, dass vielleicht zwei von drei Käsereien nach einem solchen Fall schliessen müssen.
Und wie hat es die Molkerei Gstaad geschafft, diesen Vorfall unbeschadet zu überstehen?
Es sind mehrere Faktoren, die uns geholfen haben. Das eine ist sicher die Kommunikation. Wir haben immer offen und transparent gesagt, wie die Situation ist. Keine Salamitaktik, das hat uns geholfen. Und wir konnten zu jener Zeit in den neuen Betrieb umziehen. Wir mussten also nicht sanieren, sonst hätte das viel länger gedauert. Und nicht zuletzt hat uns Corona geholfen – das war 2020 das dominante Thema. Das hat etwas von uns abgelenkt. Aber wir haben in der Tat auch unsere Hausaufgaben gut gemacht. Am 3. Juli mussten wir die öffentliche Warnung herausgeben, oder – wie es formell heisst – den Produkterückruf organisieren. Am 3. August – also auf den Tag genau einen Monat später – konnten wir wieder liefern.
Und wie haben die Kunden und Abnehmer reagiert?
Wir hatten viel Goodwill vonseiten der Kunden und Abnehmer. Insbesondere von Coop. Deren Einkäufer hat stets betont, dass das Produkt, wenn es wieder in Ordnung sei, nicht zur Diskussion stehe.
Betroffen war nur der Kräuterkäse. Wie kommt das?
Genau, andere Käsesorten wurden nicht kontaminiert. Die Kräuter kamen am Standort im Grund in einer Art Container, der nur für das eingerichtet war, auf den Käse. Kontaminationsquelle für die Listerien war der dortige Ablauf. Es war unser Glück, dass wir damals nicht alles im gleichen Haus machten. Deshalb konnten wir im Hauptbetrieb weiter produzieren. Heute haben wir jedoch die ganze Produktion zentriert am neuen Standort. Und produziert wird dort fast unter Spitalhygiene.
Wie läuft aktuell und ganz allgemein die Käsevermarktung?
Es ist immer ein Auf und Ab. Im Moment hat man wohl die Talsohle erreicht. Man hatte grosse Schwierigkeiten beim Export – vor allem beim Greyerzer. Und wenn dieser harzt, hat das Auswirkungen auf die ganze Branche. Greyerzer ist jene Sorte, die mit Abstand am meisten produziert wird. Etwa 30’000 Tonnen jährlich. Kann dieser Käse plötzlich nicht mehr abgesetzt werden, kommt er auf den Inlandmarkt und das hat Einfluss auf die anderen Sorten.
Warum ist der Export eingebrochen?
Das hat mehrere Gründe. Im Frühling 2023 hat man die Preise erhöht und gleichzeitig ist in Deutschland die Inflation gestiegen. Und Deutschland ist das wichtigste Exportland für Schweizer Käse. Auch der starke Franken ist ein Problem und sorgt für massive Auswirkungen. Die Deutschen können es sich schlicht nicht mehr leisten, Schweizer Käse zu kaufen. Das führte dazu, dass es viel zu viel Ware auf dem Markt gab. Über mehrere Monate konnte man beim Grossverteiler Coop den Greyerzer permanent für 18 Franken das Kilo kaufen. Das ist für einen sehr guten Käse relativ günstig. Er wird von den Kunden natürlich gekauft und deshalb kommen die anderen Käse unter Druck. Aber ich denke, wenn die Lagerbestände bereinigt sind, wird die Situation wieder besser.
Welcher Käse der Molkerei Gstaad wird im Saanenland am meisten gegessen? Oder anders gefragt: Welcher ist der Verkaufsschlager?
Mit Abstand der bestverkaufte Käse ist unser Kräuterkäse. Aber der geht zu circa 95 Prozent an Coop. Ich nehme an, der gefragteste Käse im Saanenland ist der Hobelkäse. Aber das ist wirklich nur eine Vermutung, es gibt keine Erhebungen.
Wie viele Tonnen Käse produziert die Molkerei Gstaad im Jahr?
Wir produzieren etwa 220 Tonnen Käse selber und kaufen rund 60 Tonnen Alpkäse pro Jahr dazu – primär von unseren Genossenschaftsmitgliedern. Diese produzieren den Käse selber auf der Alp. Zwischen 85 und 90 Prozent werden zu Hobelkäseröllchen verarbeitet. Wir produzieren im Schnitt elf Käsesorten.
Wie ist die Nachfrage nach Bio?
(Überlegt.) Wahrscheinlich stagnierend. Wir selber stellen keine Bioprodukte her. Wir bekommen zwar etwas Biomilch geliefert, aber sie wird der normalen Milch zugefügt. Wir haben zu wenig und vor allem zu unregelmässig Biomilch, um daraus Bioprodukte herzustellen.
Was bräuchte es, um Bioprodukte zu produzieren?
In erster Linie genügend Biomilch. Und in der Produktion dürfte es nicht zu einer Vermischung kommen. Das bedeutet, dass man entweder die Biomilch als erste verarbeitet oder die Anlage vorher gut reinigt. Eine gut gereinigte Anlage hat man in der Regel am Morgen. Die Bioprodukte betrieblich zu zertifizieren wäre hingegen kein grosses Problem.
Angenommen, Sie bekämen genügend Biomilch geliefert, wären Bioprodukte dann eine Option?
Wenn wir ein Produkt, zum Beispiel einen Käse, in Bioqualität das ganze Jahr anbieten könnten, würden wir das sicher tun. Aber wir bekommen während der Alpsaison fast keine Milch geliefert und absolut null Bio. Unsere Kunden – ich rede jetzt nicht vom Laden, dort ginge es noch –, die Grossverteiler Coop und Migros, wollen ihre Ware aber regelmässig.
Joghurt könnten wir zum Beispiel in Bioqualität produzieren. Aber diesen verkaufen wir nur im Laden und bei ein paar Wiederverkäufern. Bio ist eigentlich kein Thema für uns, wir wurden auch nie wirklich gefragt. Unsere Produkte, die wir für Coop produzieren, gehören alle zur Pro-Montagna-Linie.
Werden Produkte der Molkerei Gstaad exportiert?
Wenig. Es geht nicht gerade gar nichts ins Ausland, aber den durchschlagenden Erfolg hatten wir bisher nicht. Ab und zu liefern wir etwas nach Australien, in die USA oder nach England. In der Regel sind das kleinere Ladenketten, die ab und zu ein paar Käse bestellen, und dann organisieren wir das.
Gibt es Heimwehsaaner, die Käse aus der alten Heimat bestellen?
Wir haben schon hie und da Anfragen. Aber weil wir nicht Mitglied der EU sind, ist es äussert schwierig, Käse von der Schweiz ins Ausland zu schicken. Ist es jemandem wirklich sehr, sehr wichtig, schicke ich ein Paket. Aber das ist niemals rentabel und wir wollen das bestimmt nicht fördern.
Besuchen Sie Messen im In- und Ausland?
Als Besucher ja, aber nicht mehr als Aussteller. Es bringt nichts, Produkte zu präsentieren, die man nirgends kaufen kann. Wir waren einmal in Dubai – es hat nichts gebracht. Ausser Spesen nichts gewesen, könnte man sagen. Und vor einigen Jahren war ich das eine oder andere Mal in Deutschland. Aber es ist äusserst schwierig, Marktanteile zu gewinnen, es braucht einen langen Atem. Sehen Sie: Bei Lidl und Aldi kostet der Käse über die Theke sieben oder acht Euro das Kilo. Das wollen wir nicht, das ist nicht unser Anspruch, unser Segment. Und wenn wir zwischen 30 und 35 Euro liegen, kommen nicht mehr so viele Läden in Frage. Deutschland ist gross, logistisch ist es fast nicht zu bewältigen, Fuss zu fassen.
Was bringt die Zukunft?
Die wird schwieriger. Der Kaufkraftverlust ist ein grosses Thema. Käse ist ein Produkt im mittleren bis höheren Preissegment. Und wenn du wenig Kaufkraft hast, kaufst du in der Regel etwas Günstigeres. Das mache ich ja selber auch. Die Zuwanderung ist ja an sich positiv, sie bringt mehr Leute, mehr Fachkräfte in die Schweiz, aber die Zuwanderer sind in der Regel nicht unbedingt Käsekonsumenten. Aber es gibt noch eine weitere Herausforderung.
Und die wäre?
Der Veganismus. Tierische Produkte bekommen je länger je mehr einen negativen Touch. Mengenmässig ist das Segment an Veganern bisher zwar sehr klein, aber sie bekommen relativ viel Aufmerksamkeit.
Für uns als Käseproduzenten sind das Angebot und die Vielfalt riesig, aber der Kuchen wird nicht grösser. Der Pro-Kopf-Konsum ist zwar nach wie vor hoch, aber gefragt sind halt vor allem Frisch- und Weichkäse. Wir von der Abteilung Halbhart- und Hartkäse kämpfen etwas mit Stagnation.
Im Saanenland gibt es zwei Molkereien – Gstaad und Schönried. Wie ist die Zusammenarbeit?
Gut. Wir produzieren die gleichen Produkte und haben die gleichen Dienstleistungen. Somit könnten wir einander nur über den Preis «plagen», aber das würde ja niemandem etwas bringen. Wir verkaufen ihre Produkte in unserem Laden, sie verkaufen unsere Produkte in ihrem Laden. Aber bei den beiden Grossverteilern Migros und Coop sind wir ganz klar Konkurrenten. Da muss man nichts beschönigen. Ich freue mich, wenn bei einem Grossverteiler im Welschland unser Käse verkauft wird. Und umgekehrt muss man halt auch die Konkurrenz akzeptieren. So einfach ist das.
Man spricht oft vom Preisdiktat der Grossverteiler. Was ist Ihre Meinung dazu?
Den Vorwurf von Landwirten und Politikern an die Adresse der Grossverteiler wegen zu grosser Margen würde ich nicht unterschreiben. Ohne die zwei Grossverteiler geht es halt nicht. Ich würde nicht von einem Preisdiktat sprechen. Der Preis ist Verhandlungssache und wenn du gute Argumente hast, wird auch ein guter Preis bezahlt.
Zur Person

René Ryser ist seit dem 21. November 2011 Geschäftsführer der Molkerei Gstaad. Er hat eine Berufslehre als Käser und Molkerist absolviert und an der Molkereischule Rütti in Zollikofen das Meisterdiplom erworben. Bevor er nach Gstaad wechselte, arbeitete er in leitenden Positionen in der Milch- und Käseindustrie. Er war als Berufsschullehrer und Prüfungsexperte tätig, ist nach wie vor Vorstandsmitglied bei CasAlp und im Berufsverband Molkereifachleute sowie seit 2018 Präsident des Vereins «Freund:innen des nationalen Milchwirtschaftlichen Museums» in Kiesen. René Ryser ist 60-jährig, seit zehn Jahren in zweiter Ehe verheiratet und wohnt in Château-d’Oex.
Als Sektionspräsident der SVP war René Ryser in Uetendorf auch politisch aktiv. Kurz vor seinem Wechsel nach Gstaad kandidierte er als Gemeinderat. Er hätte als erster Ersatz nachrücken können. «Ich hatte damals die Schriften noch in Uetendorf. Wäre ich gewählt worden, hätte ich die Wahl angenommen», so Ryser. «Aber als erster Ersatz sah ich mich nicht verpflichtet.» Heute ist er nicht mehr politisch aktiv.
Anita Moser
Käseland Schweiz
Käsekonsum
Im weltweiten Durchschnitt wurden im Jahr 2022 ca. 3,21 Kilogramm Käse pro Kopf konsumiert. Am meisten Käse isst man in Frankreich. Der Pro-Kopf-Käse-Konsum liegt dort bei 26 Kilogramm – ein Jahr zuvor waren es 27,6 Kilogramm. Es folgen Island, Finnland, Deutschland, Estland und die Schweiz. In der Schweiz lag der Pro-Kopf-Käse-Konsum im Jahr 2022 bei rund 22,9 Kilogramm. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Käsekonsum pro Person um 1,3 Prozent abgenommen. Der Pro-Kopf-Konsum von Frischkäse und Quark stieg hingegen leicht an auf 8,5 Kilogramm.
450 Käsesorten
2022 wurden in der Schweiz rund 200’000 Tonnen Käse hergestellt. Ein Drittel wird exportiert, hauptsächlich in europäische Länder – allen voran Deutschland. Greyerzer, Mozarella und Emmentaler sind die meistproduzierten Sorten. In der Schweiz gibt es mehr als 450 Käsesorten: Hartkäse, Weichkäse, Frischkäse, Alpkäse, Bauernkäse, Hobelkäse. Der im Ausland beliebteste Schweizer Käse ist der Emmentaler. Beliebtester Käse der Schweizer ist der Greyerzer, einen ausgezeichneten Ruf geniessen auch Sbrinz, Appenzeller, Raclettekäse und Tête de Moine. Pd/moa
Quellen: statista.com, Agrarbericht 2023
Zahlen und Fakten
Die Molkerei Gstaad produziert jährlich 220 Tonnen Käse, zur Hauptsache Gstaader Bergkäse. Wenn das Vieh im Tal ist – das heisst während rund neun Monaten – nimmt die Molkerei knapp vier Millionen Liter Milch pro Jahr an. In den Monaten Juli und August kommen noch rund 100’000 Liter Milch zusammen.
140 Tonnen im Lager
Aktuell lagert die Molkerei Gstaad gut 140 Tonnen Käse. 75 Tonnen eigenen, das heisst Gstaader Bergkäse und Mutschli. 12’000 Laibe à 6kg = 72 Tonnen Gstaader Bergkäse und noch rund 70 Tonnen Alpkäse. «Wir haben immer drei Jahrgänge an Lager», so Ryser. Die Menge des eigenen Käses lasse sich besser steuern. «Im Frühling produzieren wir mehr, damit wir die Lücke im Sommer und Herbst decken können und damit wir das ganze Jahr über lieferfähig sind. Beim Alpkäse müssen wir die Menge über den Einkauf steuern.»
Alpkäse ist nicht gleich Bergkäse
Die Milch für Bergkäse stammt von Landwirtschaftsbetrieben, welche sich im Berggebiet befinden. Bergkäse wird das ganze Jahr über in Dorfmolkereien im Berggebiet hergestellt. Im Gegensatz dazu wird der Alpkäse ausschliesslich während der Sommermonate auf einer Alp – im so genannten Sömmerungsgebiet – hergestellt. pd/moa