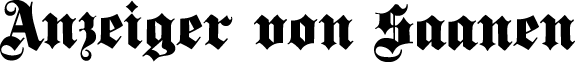Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen die zukünftige!
31.07.2025 KircheÜber Migration und Heimat
Wanderungsbewegungen gehören schon immer zur Geschichte der Menschen. Unterschiedliche Gründe können dazu führen, dass ein Volk oder Einzelpersonen die Heimat verlassen:
– der Wunsch, Erwerbsmöglichkeiten zu verbessern oder zu erschliessen (vgl. zum Beispiel die Gastarbeiter in den 60er-Jahren)
– Krieg oder Verfolgung im eigenen Land (derzeit zum Beispiel in der Ukraine, in Syrien oder in Afghanistan)
– Nomadismus als Lebensstil, um an jeweils anderen Orten neue Ressourcen zu nutzen (vgl. zum Beispiel die Sinti und Roma)
Das Gstaad Menuhin Festival nimmt diese Erfahrungen auf und stellt die Musikwochen heuer unter das Thema «Migration».
Heimweh – eine «Schweizerkrankheit»
Während vieler Jahre war die Schweiz nicht ein Einwanderungs-, sondern ein Auswanderungsland. Bevölkerungswachstum und Hungersnöte führten etwa im 19. Jahrhundert zu Massenauswanderungen. 200 Jahre zuvor flüchteten Täuferfamilien insbesondere nach Amerika, um der Verfolgung durch die Zürcher und Berner Behörden zu entgehen.
In der Fremde beginnt denn auch die literarische Beschäftigung mit dem Thema «Heimat». Das Wort «Heimweh» galt während langer Zeit ausschliesslich als Schweizer Dialektausdruck; im 16. Jahrhundert diente es zur Bezeichnung der sogenannten «Schweizerkrankheit». Davon betroffen waren vor allem Schweizer Söldner, die sich aus Armut in fremden Armeen verdingen mussten; wegen ihren Erinnerungen an die Heimat gelang es ihnen kaum, sich mit den Lebensumständen in der Fremde zu arrangieren, sie litten unter Heimweh.
Migration ist die Regel
Immerhin: Ein Blick auf die Geschichte der Menschen, von denen das Alte und das Neue Testament erzählen, zeigt, dass Wanderung, Flucht und Migration, nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Die Bibel ist von Anfang an die Erzählung von Vertriebenen, das Paradies haben die Väter und Mütter des Glaubens immer im Rücken. Abraham und Sarah, Moses und Aaron, die Propheten und ihr Volk, Jesus und seine Schüler: vor die Tür gesetzt, des Landes verwiesen, auf der Wanderschaft, auf der Suche nach einem Zuhause, das endlich Ruhe und Frieden verspricht.
«Ich bin ein Gast auf Erden!»
Der christliche Glaube verspricht kein «Schöner Wohnen» in der unbehausten Welt. Wer glaubt, ist stets im Aufbruch begriffen, das Ankommen ist vor allem eine Hoffnung und Heimat das, was noch aussteht. Die Bibel fasst dieses Lebensgefühl mit den Worten zusammen: «Ich bin ein Gast auf Erden.» (Psalm 119,19) Dieser Bestimmung zufolge eignet den Christenmenschen stets eine gewisse Fremdheit, sie fühlen sich in der Welt nie ganz zu Hause. Diese Haltung wiederum lässt einen in Bewegung bleiben. Und sie ist gefährlich, denn sie riskiert offenen Einspruch gegen die Art, wie wir uns in der Welt eingerichtet haben und führt zuweilen in den Widerstand.
Die Welt gehört nicht uns
Die genannten Worte aus dem Alten Testament führen zunächst zur Einsicht: Die Menschen sind nicht die Herren der Welt, sondern Geschöpfe inmitten von anderen Geschöpfen. Daher verbietet sich das Gebaren eines omnipotenten Herrschers, der so tut, als würde ihm die Welt gehören. Niemand braucht sich fortan aufzuplustern, jedermann kann sich nunmehr darauf beschränken, den Aufenthaltsort so zu gestalten, dass er zum Verweilen einlädt. Der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer fasst diese Erkenntnis so zusammen: «Als Gast bin ich den Gesetzen meiner Herberge unterworfen.»
Die genannte Einsicht hat weitere Folgen: Als Gast bin ich mir darüber im Klaren, dass ich nicht der Einzige bin, sondern meinen Standort mit anderen teile. Daher bin ich bestrebt, nicht nur den Gastgeber zu achten, sondern auch die anderen Gäste. Ich respektiere und würdige meine Stätte auch deshalb, weil ich, um im Bild zu bleiben, weiss: Ich bin weder der einzige noch der letzte Gast, nach mir werden weitere kommen.
Die Hoffnung auf eine andere Heimat…
Die Erkenntnis «Ich bin ein Gast auf Erden» ist freilich nur die eine Seite evangelischen Glaubens. Die andere besteht in der Hoffnung auf eine Heimat jenseits der irdischen; im Neuen Testament heisst es: «Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.» (Hebräer 13,14) Christenmenschen verfügen gleichsam über eine «doppelte Staatsbürgerschaft», und zwar «in der Welt», aber eben «nicht von der Welt». Diese Einsicht findet ihren umgangssprachlichen Niederschlag im Ausdruck «heimgehen», der in früheren Zeiten oft und zuweilen noch immer gleichbedeutend mit dem Wort «sterben» verwendet wurde und wird. Mit anderen Worten: Christenmenschen leben in der Welt und hoffen auf die himmlische Heimat.
… eine Megacity!
Diese andere Heimat, die das Christentum wie ein Gegenbild an die Wand wirft, nimmt nicht Mass an einem eidgenössischen Dorf. Ihr Vorbild ist die pulsierende, laute Stadt. Das himmlische Jerusalem ist eher eine Megacity denn ein Weiler im Simmental. Deshalb passt die Heimat, welche der christliche Glaube vor Augen stellt, ausgezeichnet in die Moderne.
Die Vision von der neuen Stadt ist ein Bild für gelingendes Leben: Menschen leben mit sich selbst und miteinander versöhnt, niemand bleibt ungetröstet, Tränen werden abgewischt und Wunden geheilt. Weder Ehrgeiz noch Konkurrenz, weder Gier noch Geltungssucht bestimmen das neue Leben, sondern Füreinander und Miteinander. Die Finsternis weicht dem Licht und der Mangel der Fülle.
Die Bitte des Unser-Vater-Gebetes, «Dein Reich komme», spricht die christliche Sehnsucht nach einer Heimat jenseits der irdischen in wohl konzentriertester Form aus.
Nie mehr ohne Dach über dem Kopf
Christenmenschen sind in ihren Lebenswelten zugleich heimatlos und beheimatet. Sie halten sich in der Fremde auf, an zuweilen unwirtlichen Orten, und hoffen auf ein heiles Miteinander. Diese Hoffnung auf die «neue Stadt», eine machtvolle Gegenwelt, tragen sie mit sich; mit ihr sind sie nie ohne Dach über dem Kopf. Und diese Hoffnung verändert den Blick auf die Welt. Sie lässt Verantwortung übernehmen und gestalten. Gelassen und getrost.
BRUNO BADER