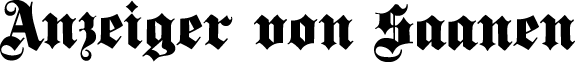Russische Musik aus dem inneren und äusseren Exil
02.09.2025 MusikVerschiedener hätten sie kaum sein können, die Werke von Schostakowitsch und Rachmaninow, die im Festivalzelt zum Motto «Migration» erklangen. Doch die Wiedergaben waren beide vortrefflich.
ERICH BINGGELI
Wie aktuell: Künstlerinnen und Künstler haben immer wieder ihr Heimatland verlassen, weil sie sich dort unwohl oder gar bedroht fühlten. Einige sind aber auch geblieben und haben der oft gefährlichen Situation die Stirn geboten. Mut gehört zu beiden Wegen. Dmitri Schostakowitsch liess sich von der Stalin-Diktatur nicht kleinkriegen und wählte gleichsam das innere Exil: den scheinbaren Rückzug in die eigenen musikalischen Welten. Dabei entstanden jedoch oft mehrdeutige Kompositionen, die sich raffiniert mit dem Regime auseinandersetzten und diesem mitunter gar den Spiegel vorhielten.
Als er im Jahre 1966 das zweite Cellokonzert (g-Moll, op. 126) schrieb, war Stalin zwar schon lange tot. Doch der Komponist blieb ein Gezeichneter und war vom langen Leiden gesundheitlich angeschlagen. Auch in dieser späten Schöpfung prallen die Gegensätze aufeinander, bald düster und mit Todesahnungen, bald tänzerisch und wegen der häufig grellen Akzente nur vordergründig heiter.
Geschichtenerzählerin
Sol Gabetta war die ideale Solistin in dieser höchst anspruchsvollen Rarität. Sie wirkte technisch absolut souverän und stets eins mit der Musik. Dabei schöpfte sie sämtliche Ausdrucksmöglichkeiten ihres Instruments aus und wurde so zur Geschichtenerzählerin, der man gebannt folgte. Kein Wunder, dass das Publikum mehr wollte – und auch erhielt: Als Zugabe, begleitet von drei Celli aus dem Orchester, erklang Pablo Casals elegischer «Song of the Birds».
Auch die Begleitung erfüllte höchste Ansprüche: Der estnische Dirigent Paavo Järvi führte das Tonhalle-Orchester Zürich mit aufs Wesentliche reduzierter Gestik zu rhythmisch präzisem, perfekt abgestimmtem Mitgestalten. Ein Sonderlob erspielten sich dabei die grossartige Hornisten- und Perkussionistengruppe.
Drang zum Bekenntnis
Einen anderen Weg als Schostakowitsch wählte Sergei Rachmaninow. Er verliess sein Land, blieb aber stets innerlich Russe – ganz gleich, ob er nun in Deutschland, in den USA oder in der Schweiz wohnte. Seine 1907 in Dresden entstandene zweite Sinfonie (e-Moll, op. 27) steht denn auch ganz in der Tschaikowski-Nachfolge – mit spätromantischem Duktus, weit gespannten Melodiebögen und dem Drang zum persönlichen Bekenntnis.
Hier wurden Järvis Gesten raumgreifender und vielfältiger. Er baute bestimmt und konsequent auf, legte wenn nötig Energien frei und liess es auch an Transparenz und Feinschliff nicht fehlen.
Das offenbar auf seinen Chefdirigenten eingeschworene Orchester ging animiert und elastisch mit, liess die Farben in allen Registern funkeln und lieh dem ebenfalls eher selten aufgeführten Werk ein Optimum an Intensität, an eigenen künstlerischen Akzenten und, dies vor allem, an herrlichem Wohlklang.
Mit kühlem Kopf
Bei alledem behielt der Dirigent stets kühlen Kopf, wohl auch, um der Gefahr des Süsslichen oder gar Kitschigen auszuweichen. Dies gelang in jeder Phase. Die Dimensionen des Tragischen und der Erschütterung allerdings blieben in dieser willensbetonten Deutung weitgehend unausgelotet.
Dennoch gab es im erfreulicherweise fast vollbesetzten Festivalzelt am Schluss grossen Jubel mit Bravorufen und eine hymnische Zugabe, welche gut zu Rachmaninow passte.