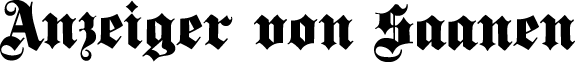500 Jahre Kirche Lauenen: Sankt Petrus, Peter Tüller und der Petersdom
13.09.2024 Lauenen, KircheVor 500 Jahren, mitten in der Reformationszeit, wurde die katholische Sankt-Petrus-Kirche in Lauenen fertiggestellt. Wie kam das Bergdorf 1524 zum eigenen Gotteshaus und einer selbstständigen Pfarrei? Wieso wurde ausgerechnet der Apostel Petrus zum Kirchenpatron? Und was hat das ...
Vor 500 Jahren, mitten in der Reformationszeit, wurde die katholische Sankt-Petrus-Kirche in Lauenen fertiggestellt. Wie kam das Bergdorf 1524 zum eigenen Gotteshaus und einer selbstständigen Pfarrei? Wieso wurde ausgerechnet der Apostel Petrus zum Kirchenpatron? Und was hat das alles mit dem Petersdom und dem Vatikan in Rom zu tun? Dies ist die Chronik einer aussergewöhnlichen Zeitepoche sowie die Geschichte von Peter Tüller, einer gefahrvollen Reise und eines lebenslustigen Papstes.
MARTIN GURTNER-DUPERREX
Für die westliche Christenheit startete das Jahr 1506 in Rom mit einem Skandal. Durch den Abbruch der über tausendjährigen, aber baufälligen Petersbasilika auf dem Vatikanhügel ging ein Kunstschatz von unermesslichem Wert verloren. An ihrer Stelle sollte nach dem Willen der Päpste – und unter dem Einfluss der Renaissance – der glanzvolle Petersdom, das grösste christliche Gotteshaus der Welt, erbaut werden, um den universellen Machtanspruch der römisch-katholischen Kirche zu untermauern.
Auf diesem heute weltberühmten Hügel «mons vaticanus» – oder schlicht Vatikan – hatte sich einst der Zirkus des römischen Kaisers Nero befunden, wo anno 64 Hunderte Christen hingerichtet wurden, da man sie fälschlicherweise der Brandstiftung Roms bezichtigte. Angeblich starb dort – kopfüber an ein Kreuz genagelt – der greise Apostel Petrus. Bereits ab dem zweiten Jahrhundert wurde sein Grab auf dem Vatikan verehrt. Kaiser Konstantin der Grosse, der das Christentum als Staatsreligion Roms eingeführt hatte, liess um 320 am gleichen Ort eine Basilika erbauen, die Peterskirche.
Via Francigena: Peter Tüllers gefahrvolle Reise nach Rom
Die Landschaft Saanen befand sich zur Zeit, als die alte Peterskirche niedergerissen wurde, noch unter der Herrschaft der Grafen von Greyerz. Sie bildete eine einzige römisch-katholische Pfarrei und gehörte zum Bistum Lausanne. Ihr Mittelpunkt war die Sankt-Mauritius-Kirche in Saanen, in Gsteig gab es zudem seit 1453 eine Filialkirche. An anderen Orten im Tal wurde in sogenannten Wegkapellen nur gelegentlich die Messe gelesen. In Lauenen existierte wohl eine schlichte Holzkapelle, deren mutmassliche Glocke von 1484 noch im heutigen Kirchturm hängt.
Der Weg vom Bergdorf Lauenen nach Saanen war jedoch sehr weit und beschwerlich, insbesondere im Winter. Ältere oder kranke Menschen konnten oft nicht mit den Sakramenten versorgt werden. Daher wünschten sich die Lauener den Bau eines eigenen Gotteshauses – schliesslich war dies den benachbarten Gsteigern ja auch gelungen. Darum wurde Peter Tüller 1518 mit dem Auftrag nach Rom geschickt, vom Papst Leo X. die Erlaubnis zu erbitten, eine dem heiligen Petrus geweihte Kirche zu bauen.
Tüllers Romreise, über die es leider keine Überlieferungen gibt, muss lang, abenteuerlich und gefahrvoll gewesen sein. In Oberitalien kämpften habsburgische und französische Heere sowie der Papst um die Vorherrschaft – auch mithilfe eidgenössischer Reisläufer, darunter mutmasslich Saaner. Zweifellos war der Lauener wochenlang zu Fuss oder auf Fuhrwerken unterwegs. Wahrscheinlich gelangte er über das Kloster Saint-Maurice im Unterwallis sowie den Grossen Sankt Bernhard ins Aostatal und die Po-Ebene. Von dort hatte er auf dem Pilgerwegnetz der Via Francigena, der mittelalterlichen «Frankenstrasse», zwei Möglichkeiten: Eine führte westlich über Genua und Pisa in die Ewige Stadt, die andere über Ancona der Adriaküste entlang.
«Gott hat uns das Papsttum gegeben, nun lasst es uns geniessen»
Diese Worte stammen vermutlich von Papst Leo X., einem freigebigen Lebemann, der neben Kunst und Literatur grosse Feste und üppige Bankette liebte. Der Kirchenfürst war ein Spross der steinreichen Florentiner Bankiersfamilie der Medici. Mit ihm herrschte im Vatikan von 1513 bis 1522 ein typischer Renaissance-Papst. Er soll – kirchlichen Massstäben gar nicht entsprechend – homosexuell gewesen sein, wie einige zeitgenössische Chroniker durchblicken liessen.
Und als leidenschaftlicher Kunstliebhaber berief Leo – wie seine unmittelbaren Vorgänger auch – zahlreiche begnadete Künstler in den Vatikan. So malte der junge Michelangelo zu jener Zeit die Decke der Sixtinischen Kapelle mit den berühmten Fresken aus.
Am päpstlichen Hof grassierten leider Korruption, Vetternwirtschaft und viele andere Missstände, wie zum Beispiel der Verkauf geistlicher Ämter – inklusive der Kardinalswürde – oder der sogenannte Ablasshandel, der Sündern gegen Geld die Verkürzung der Busszeit im Fegefeuer versprach.
Anzunehmen ist, dass Peter Tüller als frommer Katholik zum Petrusgrab in die gigantische Baustelle des Petersdoms wallfahrte. Vermutlich gehörte es sogar zu seinem Auftrag, eine entsprechende Reliquie für die Kirchengründung in Lauenen mit nach Hause zu bringen.
Wie die Audienz Tüllers beim Heiligen Vater verlief, ist ebenfalls nicht bekannt. Sicher ist, dass er mit der Erlaubnis zum Bau einer Peterskirche in sein Dorf zurückkehrte.
«Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich bauen»
Sofort nach Peter Tüllers Rückkehr aus Rom begann 1518 in Lauenen der Bau der Sankt-Petrus-Kirche, welcher bereits 1524 abgeschlossen werden konnte. Nur ein paar Jahre später wurde auch der Innenausbau mit der geschnitzten Holzdecke fertiggestellt. Der gewählte Standort auf dem erhöhten Felsrücken am Dorfrand war kein Zufall. Denn in den Evangelien hatte Jesus seine Kirche mit den folgenden Worten auf dem Apostel Petrus begründet, dessen Name Felsen bedeutet: «Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.» Also integrierte man den Felsen, dessen oberer Teil mühsam weggesprengt werden musste, als Fundament in den Turm und in die nördliche Seitenwand des Kirchenschiffs. Der Bau wurde im spätgotischen Stil ausgeführt, der insbesondere bei den spitzbogigen Fenstern und im Chorgewölbe sichtbar wird.
Über die nachfolgende Loslösung der Lauener Kirche von der Mutterpfarrei Saanen erfahren wir dank eines Berichtes von 1522. Der Pfarrherr von Saanen, Priester Johannes Huswirth, wehrte sich anfänglich gegen die Abtrennung, weil ihm dadurch ein wichtiger Teil der Zehnten und Sakramentsgebühren verloren ging. Der Bischof von Lausanne entschied schliesslich zugunsten der Lauener, erhob ihre Kirche zur eigenständigen Pfarrei und entsandte einen der zwei Hilfsgeistlichen von Saanen als ersten katholischen Pfarrer ins Bergdorf.
Gräfliche Pleite, die Reformation und der Lauener Bildersturm
Am 31. Oktober 1517 nagelte der Augustinermönch Martin Luther – ursprünglich Luder – seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Sie richteten sich gegen die damaligen Missstände in der römischkatholischen Kirche und lösten die Reformation aus. Insbesondere den Ablasshandel, durch den enorme Geldsummen aus ganz Europa für den Neubau des Petersdoms in den Vatikan flossen, bezeichnete Luther als «lächerlichen Betrug». Während Papst Leo X. die drohende Kirchenspaltung noch als blosses «Mönchsgezänk» abtat, verbreitete sich die protestantische Bewegung in deutschen Landen wie ein Flächenbrand. Auch in der Stadt Bern wurde 1528 die Reformation vollzogen.
Als 1554 über den Grafen Michael von Greyerz der Konkurs verhängt wurde, erwarb Bern aus der Konkursmasse die Landschaft Saanen und das Pays-d‘Enhaut. Sogleich wurde der Dekan Johannes Haller vom Berner Rat beauftragt, die Reformation auch in den hiesigen Pfarreien durchzusetzen. Zuerst stiess der Reformator zwar auf heftigen Widerstand, doch schliesslich konnte er die Einwohner für die neue Lehre gewinnen. Hernach wurden auch in Lauenen die Altäre, Heiligenbilder, Kreuze und Statuen von den Bilderstürmern herausgerissen und verbrannt. Teile sollen aber – etwas ironischerweise – beim Bau der neuen Kanzel und des Pfarrhofs verwendet worden sein.
Am 17. Januar 1556 hielt Haller in der Kirche Lauenen die erste reformierte Predigt. Seit Johannes Huss nur drei Monate später seine Stelle als erster reformierter Pfarrer Lauenens angetreten hatte, hat sich die Kirche nur unwesentlich verändert. Neueren Datums ist, neben der Orgel und der Empore, ein Teil der Holzverkleidung auf der Nordseite des Schiffs. Interessant ist sie, weil sie heute den Felsen verbirgt, welcher dem Bauwerk einst die nötige Solidität und zusammen mit dem Apostel Petrus den Namen gegeben hat.
Und was ist aus dem neuen Petersdom in Rom geworden? Er wurde nach vielen Verzögerungen erst 1626 fertiggestellt, genau 120 Jahre nach dessen Baubeginn und 102 Jahre nach der Einweihung der Petruskirche in Lauenen. Mögen diese so verschiedenen, aber durch die Geschichte und den Glauben miteinander verbundenen Gotteshäuser noch viele weitere Jahre Gläubigen wie Besuchenden Freude und Hoffnung schenken, zu welcher Konfession sie auch gehören.
Am Sonntag, 22. September wird das 500-Jahr-Jubiläum der Kirche in Lauenen gebührend gefeiert (siehe Inserat in dieser Ausgabe).
Quellen: Robert Marti-Wehren: Aus der Geschichte der Kirche und des kirchlichen Lebens der Gemeinde Lauenen. In: Saaner Jahrbuch 1974, Hrsg. Ulrich Chr. Jaggi, Verlag Buchdruckerei Müller, Gstaad. Robert Marti-Wehren: Die Kirche von Lauenen im Saanenland. Die Berner Woche, Band 33/1943. Erhard Gorys: Lexikon der Heiligen. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1997. Holger Finze-Michaelsen, Klaus Völlmin: Alte Kirchen im Simmental und Saanenland. Kopp Druck + Grafik AG, Zweisimmen, 1. Auflage 2008. John Julius Norwich: The Popes. Chatto & Windus, 1st Edition 2011. Historisches Lexikon der Schweiz (HLS); en.wikipedia.org
«KIRCHENHEILIGE IM SAANENLAND»
In der dreiteiligen Serie geht es um die Kirchenheiligen unserer Region. Beleuchtet werden nicht nur ihr Ursprung, ihre Bedeutung und ihr Weg hierher, sondern auch der geschichtliche Kontext über unseren Tellerrand hinaus.
Teil 1: Sankt Petrus, Kirche Lauenen
Teil 2: Heilige Mauritius & Joder, Kirchen Saanen und Gsteig
Teil 3: Sankt Nikolaus, Kirche Rougemont und Kapälli Gstaad
DER «MENSCHENFISCHER»: SIMON PETRUS
Simon Petrus war einer der zwölf Apostel, die Jesus Christus nachfolgten. Petrus lebte vor gut 2000 Jahren am See Genezareth in Galiläa. Er war ein einfacher Fischer ohne jegliche Bildung. Nach einem grossen Fang sagte Jesus Christus zu ihm, er werde aus ihm einen «Menschenfischer» machen. Petrus wurde in der Folge von Jesus zum Begründer seiner Kirche bestimmt. Nach Jesu Kreuzestod begegnete ihm der Auferstandene als einem der Ersten. Auch an Pfingsten bei der Ausschüttung des Heiligen Geistes war er dabei. Fortan missionierte er mit seinen Mitaposteln, und es entstanden viele christliche Gemeinden, insbesondere in Kleinasien, der heutigen Türkei, und Griechenland. Schliesslich soll der Apostel zusammen mit Paulus auch in Rom tätig gewesen sein und dort den Märtyrertod erlitten haben. Laut der Tradition – wofür es aber keine Belege gibt – war Petrus der erste Papst und Bischof der Stadt. Auf ihn berufen sich die Päpste bis heute als dessen Nachfolger und Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Sein Attribut: der Schlüssel zur Himmelstür (Abbildung: Fresko Mauritiuskirche in Saanen). Auf dem rechten Teil des Wappens von Lauenen ist neben dem Kranich ebenfalls ein Petrusschlüssel zu sehen.
QUELLE: EVANGELIEN DER BIBEL, NEUES TESTAMENT
DIE REFORMATION: LUTHER, ZWINGLI, CALVIN UND CO.
Die Reformation Martin Luthers von 1517 ist der Ursprung des Protestantismus in Abgrenzung zur katholischen Kirche. Sie richteten sich gegen die damaligen Missstände in der römisch-katholischen Kirche. Luthers Hauptgrundsätze sind die fünf «solas» (lat. allein): die Bibel als alleinige Grundlage des Glaubens, Errettung allein durch die Gnade Gottes und allein durch den Glauben, ewiges Leben allein durch Jesus Christus und die Ehre gebührt Gott allein. Wichtige Reformatoren in der Eidgenossenschaft waren Huldrych Zwingli (Abbildung: Porträt von Hans Asper, 1549) und Heinrich Bullinger in Zürich (1523) sowie Johannes Calvin in Genf (1536). Zwinglis Reformation verbreitete sich auch in Bern, Basel und St. Gallen sowie im süddeutschen Raum und Elsass. Bullingers Theologie prägte die anglikanische Reformation in England, während Calvins Lehren sich in der Westschweiz, Frankreich, Holland, Schottland und später in den USA ausbreiteten. 1549 kam es zur Einigung zwischen den Deutschund Westschweizer Reformierten, die bis heute für die evangelisch-reformierten Landeskirche der Schweiz Gültigkeit hat.
QUELLE: HISTORISCHES LEXIKON DER SCHWEIZ HLS (PROTESTANTISMUS)
DIE RENAISSANCE: WIEDERGEBURT DER ANTIKE
Die Renaissance, auf Deutsch Wiedergeburt, bezeichnet ungefähr die Epoche zwischen den Jahren 1420 und 1600 und folgte auf das Mittelalter mit den romanischen und gotischen Kunstund Baustilen. Die Wiedergeburt bezog sich u.a. auf die Wiederentdeckung der Architektur, Bildhauerei und Malerei der griechischen und römischen Antike (z.B. des Pantheons in Rom, Bild links).
Ihren Ursprung hatte die Renaissance in Florenz in Oberitalien, wo die Bankiersfamilie der Medici als Kunstförderer eine herausragende Rolle spielte. Auch am päpstlichen Hof im Vatikan entstanden nach diesem Vorbild grosse Bau- und Kunstwerke, die durch archäologische Funde in den antiken römischen Ruinen der Stadt zusätzlich befruchtet wurden. Mit ihrem Fokus auf Bildung und Freiheit des Menschen beeinflusste die Renaissance ebenfalls die Philosophie, Literatur und Wissenschaft, welche in der Folge zur Kritik an der Kirche führte. Die Renaissance wurde ab dem 17. Jahrhundert vom Barock abgelöst.
QUELLE: STUDYFLIX.DE (RENAISSANCE)