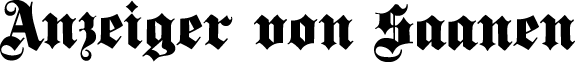Kennen Sie Fräulein Hoffnung? Über eine evangelische Tugend
27.09.2024 KircheIn diesen Zeiten ist es nicht einfach, Hoffnung zu finden, denn vielerlei Krisen und Konflikte prägen die Welt. Viele empfinden deshalb Angst und Unsicherheit oder Wut und Ohnmacht. Sie bewegen sich zwischen Apathie und Alarmismus.
Die «Gesellschaft für deutsche Sprache» sagt: Der Begriff «Krisenmodus» ist das «Wort des Jahres 2023». Und zu den gesellschaftlichen Bedrohungen gesellen sich bei vielen Menschen persönliche Rückschläge, Enttäuschungen oder Verluste. Die Universität St. Gallen erstellt jeweils einen sogenannten Hoffnungsbarometer. Für das Jahr 2024 zeigt er: Junge Leute sind hoffnungsloser als noch in den Jahren zuvor und glauben weniger an eine gute Zukunft.
Auch Gott macht es einem nicht leicht. Denn hier und dort besteht ein Widerspruch zwischen seinem Versprechen, die Schöpfung zu begleiten und zu erhalten, und dem Zustand der Welt. Gewiss, für unser Versagen können wir nicht den Schöpfer verantwortlich machen, doch es gibt Menschen, die ohne Zutun von niemandem in Not, Verzweiflung und Elend geraten.
Krise bezeichnet den Zeitpunkt vor einer Wende
Die Bedeutung des Wortes «Krise» allerdings hat sich verändert: Ursprünglich bezeichnete der Begriff den Zeitpunkt vor einer Wende, die sowohl zum Guten wie auch zum Schlechten führen konnte. Heute dagegen meint «Krise» ausschliesslich den Niedergang und die Katastrophe. Ich halte die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, mit der Möglichkeit des doppelten Ausgangs, für besser, denn eine Lebenskrise kann sehr wohl dazu führen, dass ich wachse und reife.
Die Hoffnung ist eine evangelische Tugend. Als Tugend wiederum wird eine Verhaltensweise bezeichnet, die mir selbst und anderen guttut. Seit der Antike stellt man sich die Tugenden als junge Frauen vor. Und zwar nicht nur, weil das Wort in Latein – ebenso wie in Deutsch – den weiblichen Artikel verlangt, sondern auch, weil eine Tugend erst mit Gesicht und Körper anschaulich wird.
Das Gebet gräbt die Hoffnung in die Seele
Nun aber: Wer oder was vermag die Hoffnung zu nähren?
Ein erstes Nahrungsmittel der Hoffnung ist meines Erachtens das Gebet. Denn: Weder philosophische Erklärungen noch theologische Systeme versöhnen einen mit den Widersprüchen der Welt und des Lebens. Die Welt geht nicht immer auf und mein Leben manchmal auch nicht. Im Gebet aber springe ich weiter, als ich eigentlich springen kann; was ich nicht mit Argumenten sagen kann, das behaupte ich im Gebet: Dort lobe ich Gottes Güte, selbst wenn ich sie vermisse; dort sage ich sogar unter Tränen: «Du bist mein Fels und mein Schutz!» Im Gebet und nur im Gebet bin ich gewiss, dass Gott auch im finsteren Tal an meiner Seite ist. Das Gebet ist ein Ort tollkühner Hoffnung, das Gebet gräbt die Hoffnung in die Seele. Wer betet, zieht sich nicht zurück ins Private und Innerliche, nein, im Gegenteil, wer betet, gibt die Welt nicht auf.
In den Schuhen der Eltern watscheln
Das zweite Nahrungsmittel der Hoffnung ist die Tradition. Eine Metapher mag zur Veranschaulichung dienen: Wenn Kinder klein sind, watscheln sie gerne in den Schuhen und Pantoffeln der Eltern durch die Wohnung; sie spielen, als wären sie erwachsen. Nun, was tun Christenmenschen, wenn sie im Glaubensbekenntnis sagen «Auferstanden von den Toten»? Was tun sie, wenn sie mit dem Psalm beten «Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts»? Sie watscheln in der Sprache ihrer Tradition durch die Kirche. Gewiss, zuweilen passen diese Worte nicht ganz, wir haben sie uns nicht ausgedacht. Oft sind es zu grosse Worte für einen kleinen Glauben. Manchmal ist die Sprache der Tradition unserer kargen Hoffnung fremd. So fremd, wie die Schuhe der Erwachsenen den Kindern fremd sind. Aber wir laufen in ihnen.
Ich halte es für ein Glück und einen Segen, dass ich meine kleine Hoffnung in einer Fremdsprache, der Sprache meiner Vorfahren, äussern kann. Ich lese in meiner Bibel «Die Erde ist voll von deiner Güte!» Wenn ich dann sehe, was in der Welt geschieht, zweifle ich an diesem Satz. Aber so hat Bonhoeffer im Gefängnis gebetet und so spreche ich diesen Satz nach. Ich berge meinen Glauben in einer fremden Sprache, in den Geschichten und Bildern von gestern. Das bedeutet: Ich bin nicht allein.
Nicht einmal mit meinem Glauben. In den Formeln der Tradition springe ich weit über mich selbst hinaus. Ich lese den andern ihre Hoffnung von den Lippen und lerne ihren Glauben. Mein Herz verantwortet nicht die grossen Worte, ich selbst kann nur stammeln; deshalb rede ich mit der Sprache meiner Kirche und Tradition.
Ich will nicht auf mich und nur auf mich zurückgreifen, auch dann nicht, wenn es um meinen Glauben und meine Hoffnung geht. Ja, ich weiss, es gibt Menschen, die es nicht ertragen, Söhne oder Töchter zu sein; sie halten es kaum aus, Herkunft und Tradition zu haben. Ich finde: Wir armselig ist es, immer der Erste einer Reihe sein zu müssen und nichts und niemanden hinter sich zu haben. Christenmenschen dagegen hoffen: Wir kommen nicht aus dem Nichts. Und wir gehen nicht ins Nichts.
Wer alleine ist, verhungert
Das dritte Nahrungsmittel der Hoffnung ist die Gemeinschaft. Man kann nicht als Einzelner überleben; wenn man alleine ist, verhungert man. Unser grosses Geschenk ist: Wir sind nicht alleine, die Kirche ist eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Sie nehmen Anteil aneinander, sie feiern Gottesdienste, sie lesen einander die Hoffnung von den Lippen.
Eine Geschichte aus der klösterlichen Tradition erzählt: Ein Mönch verfällt in eine tiefe seelische Dürre und bittet seinen Abt, von den Gebeten dispensiert zu werden; er sagt: «Mein Herz kann den Worten der Psalmen nicht folgen.» Der Abt erlaubt ihm nicht, dem gemeinsamen Gebet fernzubleiben. Er zwingt ihn auch nicht, mitzubeten, was er nicht beten kann. Der Abt sagt zum Mönch: «Geh hin und schau, wie deine Brüder beten!» Der Mönch in seiner geistlichen Armut soll sich nicht selber Massstab sein, sondern hingehen und seine Dürre mit der Möglichkeit vergleichen, die seine Brüder schon haben. Noch kann er nicht selber hoffen und beten. Aber er kann zusehen, wie andere es können. Damit ist seiner Kargheit die Absolutheit genommen. So ist die Kirche eine Art Glaubensverleihanstalt.
Die Hoffnung fälscht Bilanzen
Wer hofft, gibt den letzten Grund des Glaubens nicht auf und bekennt: Gott wird kommen und das Leben nicht der Vernichtung überlassen. Wer aber so betet, der oder die begibt sich immer wieder in Widerspruch zur Welt und ihren Grausamkeiten. Deshalb: Die Hoffnung lässt uns in unserer Zeit nie ganz zu Hause sein, sie macht uns zuweilen zu Fremden im eigenen Land.
Hoffen bedeutet nicht zu sagen: «Es kommt schon gut!»; die Hoffnung garantiert nicht den guten Ausgang der Dinge. Die Hoffnung ist Widerstand gegen Verzweiflung und Mutlosigkeit. Sie stellt nicht nur fest, was ist, sondern vermutet schon in den kleinsten Vorzeichen das ganze Gelingen. Die Hoffnung ist eine wunderbare untreue Buchhalterin: Sie fälscht Bilanzen und behauptet den guten Ausgang des Lebens auch dort, wo dieser noch nicht abzusehen ist. Sie ist die stärkste der evangelischen Tugenden: In ihr wohnt die Liebe, die nicht aufgibt, und der Glaube, der den Tag schon in der Morgenröte sieht.
BRUNO BADER