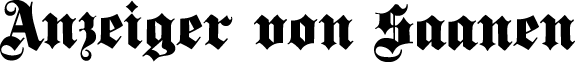Sanierung in luftiger Höhe
08.08.2025 SaanenlandZwischen Gstaad und Gsteig sanieren Fachkräfte zurzeit eine zentrale Höchstspannungsleitung der Schweiz – in luftiger Höhe und unter besonderen Bedingungen. Denn der Stromfluss wird am Morgen unterbrochen, damit die Arbeiten beginnen können. Am Abend wird die Leitung wieder eingeschaltet. Dass eine Leitung täglich vom Netz genommen und wieder in Betrieb genommen wird, ist schweizweit einzigartig. Was technisch herausfordernd klingt, ist Alltag für das Team vor Ort. Im Interview erklärt Swissgrid-Sprecher Jan Schenk, warum die Sanierung notwendig ist und wie der Zustand der Leitungen überwacht wird.
JONATHAN SCHOPFER
Wer in diesen Tagen von Gstaad Richtung Gsteig fährt, sieht sie bei schönem Wetter: orangfarbene Punkte oben auf den hohen Strommasten. Dort arbeiten Fachkräfte, Monteure und Bauleiter in Warnwesten an der Sanierung der Höchstspannungsleitung zwischen Chamoson (VS) und Mühleberg (BE) (siehe Karte).
Zur Baustelle begleitet uns Jan Schenk, Mediensprecher von Swissgrid. Swissgrid ist Eigentümerin des Schweizer Übertragungsnetzes – für die Sanierung wurden insgesamt fünf Montagefirmen beauftragt «Wir erneuern die Höchstspannungsleitung auf einer Länge von rund 50 Kilometern», erklärt er.
Technische Präzision auf jedem Mast
Bevor es zur Baustelle geht, heisst es: Warnweste anziehen, Helm aufsetzen. Bauleiter Armin Mathier von der Arnold AG führt zum Masten, wo gerade gearbeitet wird. «Hier ziehen wir neue Leiterseile über mehrere Kilometer ein», erklärt er. «Die Seile werden unterwegs miteinander verbunden. Dabei entstehen sogenannte ‹Seilsäcke› – das sind Schlaufen aus Reserveseil.» Anschliessend werden die Seile so gespannt, dass sie korrekt durchhängen – weder zu stark noch zu schwach. Das sei entscheidend für den Sicherheitsabstand zum Boden. Die ideale Spannung wird mithilfe von Tabellen berechnet, in denen auch die aktuelle Temperatur berücksichtigt wird. Denn bei schönem Wetter dehnen sich die Seile aus, bei Kälte ziehen sie sich zusammen. «Mit einem Zielfernrohr überprüfen wir dann, ob alles exakt passt», so Armin Mathier.
Ein besonderes Projekt
Unter dem Mast liegen die verschiedenen Teile bereit. Ein rund vier Meter langer Isolator wird gerade nach oben manövriert. Früher bestanden diese Isolatoren aus Porzellan, heute aus modernem Kunststoff.
«Das möchte ich noch betonen: Mit den Landwirten haben wir hier bei diesem Projekt keine Probleme», sagt der Bauleiter. «Schliesslich lagern wir teils Geräte auf ihrem Land. Eine gute Kommunikation ist entscheidend.»
Eine weitere Besonderheit macht die Baustelle im Saanenland schweizweit einzigartig: «Jeden Abend wird die Leitung durch unsere Netzleitstelle in Aarau wieder unter Strom gesetzt – und am Morgen spannungsfrei geschaltet», so Schenk. Grund dafür ist die Systemrelevanz der Leitung. Sie verbindet das Wallis mit dem Mittelland und transportiert grosse Mengen Energie. Eine längere komplette Abschaltung ist nicht möglich – sie würde die Netzstabilität gefährden.
Sicherheitsmassnahmen
«Vor jedem Arbeitsbeginn müssen wir die Leitung vollständig erden, um mögliche Restspannungen durch Induktion zu vermeiden», erklärt Jan Schenk. Bei Gewittern werden die Arbeiten vorsorglich eingestellt.
Bauleiter Armin Mathier bringt es auf den Punkt: «Sicherheit hat oberste Priorität. Masten und Schrauben kann man ersetzen – nicht aber die Menschen.»
Die Monteure auf den Masten kommen aus unterschiedlichen Berufen – doch eines müssen sie alle gemeinsam mitbringen: absolute Schwindelfreiheit. «Einmal hatte ich einen Kletterer, der hier anfangen wollte», erzählt der Bauleiter schmunzelnd. «Er kam am Morgen – und kündigte am Mittag. In der Höhe arbeiten war nichts für ihn.»
JAN SCHENK, MEDIENSPRECHER VON SWISSGRID, IM INTERVIEW
«Wir überwachen das Netz rund um die Uhr»
Von Juni bis Ende Oktober wird im Saanenland an der Erneuerung der Hochspannungsleitungen gearbeitet. Warum ist diese Sanierung notwendig? Wie werden Stromleitungen überwacht? Und weshalb dauern politische Prozesse oft zu lange? Jan Schenk, Mediensprecher der nationalen Netzbetreiberin Swissgrid, spricht über die Arbeiten im Saanenland.
JONATHAN SCHOPFER
Warum muss diese Leitung saniert werden?
Diese Leitung ist rund 70 Jahre alt. Die Seile bestehen noch aus Kupfer, das in Höchstspannungsleitungen heute nicht mehr prioritär verwendet wird. Wir ersetzen die alten Leiterseile – also jene, durch die der Strom fliesst – durch moderne Aluminiumseile mit Stahlkern. Auch die Masten werden verstärkt, die alten Isolatoren ausgetauscht und teils die Fundamente erneuert.
Können Sie uns die Dimension dieses Projektes erläutern?
Insgesamt werden auf rund 50 Kilometern 155 Kilometer Leiterseile und 106 Masten erneuert – durch fünf Montagefirmen in mehreren Etappen. Das Projekt umfasst neben dem Austausch der Leiterseile und Isolatoren auch 24 Fundamente. Zudem versetzen wir auf dem Sanetschpass drei Masten, die 2017 durch einen Felssturz beschädigt worden sind.
Wie überwachen Sie eigentlich den Zustand der Leitungen im Lauf der Jahre?
Über die Netzleitstelle in Aarau sowie mithilfe von Sensoren entlang der Leitung, die Belastungen und Temperaturdaten übermitteln. Zusätzlich setzen wir regelmässig Drohnenflüge ein, um den Zustand der Seile visuell zu prüfen. So erkennen wir frühzeitig, wann eine Leitung an ihre Grenze kommt, und können rechtzeitig handeln. Wir überwachen das Netz rund um die Uhr.
Wie steht es um die Versorgungssicherheit in der Region Saanenland?
Die Stromversorgung ist jederzeit gewährleistet. Selbst wenn ein Netzteil ausfällt, greifen andere Elemente im Netz ein. Auch jetzt, wenn die Arbeiten stattfinden und der Strom vom Wallis abgestellt wird, kommt der Strom von anderen Netzen. Im Winter importieren wir bis zu 40 Prozent des Stroms – vor allem aus Frankreich. Im Sommer exportieren wir dagegen viel Strom aus Wasserkraft. Die Swissgrid sorgt dafür, dass das Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch zu jeder Zeit stabil bleibt.
Wie verändert sich die Stromproduktion in der Schweiz?
Früher hatten wir grosse, zentralisierte Kraftwerke – zum Beispiel Kernkraftwerke im Mittelland oder grosse Wasserkraftwerke in den Alpen. Heute wird viel dezentral produziert, unter anderem durch alpine Photovoltaik. Diese Produktionsform ist weniger planbar, weshalb ein stabiles und leistungsfähiges Übertragungsnetz umso wichtiger ist. Es verbindet die Regionen und sorgt dafür, dass die Energie dorthin gelangt, wo sie gebraucht wird.
Gibt es Herausforderungen durch politische Rahmenbedingungen?
Ja, bis zur Bewilligung von Netzprojekten kann es durch Einsprachen sehr lange dauern – teils 20 bis 30 Jahre. In dieser Zeit verändert sich jedoch das ganze Energiesystem. Deshalb wird aktuell im Parlament über den sogenannten Netzexpress diskutiert. Ziel ist es, gewisse Abläufe im Bewilligungsverfahren zu beschleunigen.
Was sind die nächsten Schritte auf der Baustelle?
Aktuell befinden wir uns in der letzten Phase der Erneuerung: Die neuen Leiterseile werden eingezogen und korrekt gespannt. Dabei kommt es auf höchste Präzision an. Bis Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein – dann geht die Leitung wieder vollständig in Betrieb. Ab 2030 steht eine Gesamtsanierung des Abschnitts zwischen Gstaad und Mühleberg an.