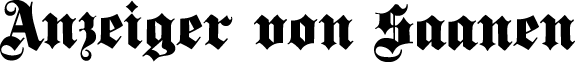Kirchenserie Teil 2: Heilige Mauritius & Joder: der Märtyrer, der Bischof und ein Massengrab
31.10.2024 KircheDer Märtyrer Mauritius und der heilige Joder: zwei Namen, die jahrtausendealte Ereignisse und Sagen heraufbeschwören – wie den Untergang der Thebäischen Legion, den Hunneneinfall, die Völkerwanderungen, den Zusammenbruch Roms und das Schicksal der Burgunder. Sie ...
Der Märtyrer Mauritius und der heilige Joder: zwei Namen, die jahrtausendealte Ereignisse und Sagen heraufbeschwören – wie den Untergang der Thebäischen Legion, den Hunneneinfall, die Völkerwanderungen, den Zusammenbruch Roms und das Schicksal der Burgunder. Sie alle haben eine bemerkenswerte Verbindung zur altehrwürdigen Abtei Saint-Maurice im Unterwallis. Wie und wann sind die beiden Heiligenfiguren in das Saanenland gekommen? Eine Spurensuche im Wallis und in den Kirchen von Saanen und Gsteig.
MARTIN GURTNER-DUPERREX
Im Jahr 406 nach Christus kam es am römischen Schutzwall beim Rhein zum grossen Durchbruch germanischer Kriegsverbände. Darunter befanden sich auch die Burgunder, die ursprünglich aus Skandinavien stammten. Die von den Goten ausgelösten Völkerwanderungen führten sie schliesslich bis in die Rhein-Main-Gegend. Durch den Rheinübergang suchten sie vielleicht bessere Lebensbedingungen in Gallien, womöglich waren sie – so wie im mittelalterlichen «Nibelungenlied» besungen – auf der Flucht vor den Hunnen.
Von den Römern wurden die Burgunder ein paar Jahrzehnte später als inzwischen Verbündete – «foederati» – im Waadtland und Schweizer Mittelland als Puffer zur Nordgrenze neu angesiedelt. Am 4. September 476 setzte der germanische Heerführer Odoakar jedoch den letzten Kaiser Romulus Augustus – verächtlich «Augustulus» (das Kaiserlein) genannt – ab. In der Folge brach das römische Westreich endgültig zusammen. Im vorherrschenden Machtvakuum besetzten die Burgunder von der Westschweiz aus Teile Südostfrankreichs, das Rhonetal und das Wallis.
Mauritius und der Untergang der Thebäischen Legion
Es war der burgundische König Sigismund, der aufgrund seines Übertritts zum Katholizismus in Agaunum im Unterwallis über der Grabkapelle des heiligen Märtyrers Mauritius im Jahr 515 eine grosse Wallfahrtsbasilika errichtete und sie zum Nationalheiligtum machte.
Mauritius soll in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts im Sudan geboren worden sein. Er war der Befehlshaber der Thebäischen Legion, die zur römischen Orientarmee gehörte und nur aus Christen bestand. Diese wurde vom ägyptischen Theben nach Rom entsandt und 303 weiter über die Alpen nach Agaunum. Zu der Zeit startete im Römischen Reich die historisch belegte Christenverfolgung unter Mitkaiser Maximian. Laut einer Überlieferung erhielten die Thebäer den Befehl, den römischen Göttern Opfer darzubringen. Weil sie sich weigerten, wurde jeder zehnte Legionär dezimiert.
Zudem lehnten es Mauritius und seine Gefährten ebenfalls ab, gegen christliche gallische Aufständische vorzugehen. In der Folge erlitt die gesamte Einheit, wohl über 3000 Mann, den Märtyrertod.
Um 380 wurden ihre Gebeine von Joder, dem Bischof von Octodurum (Martigny), entdeckt und geborgen. Darüber liess er die Kapelle errichten, die schon bald zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte des Mittelalters werden sollte.
Das Mauritiusgrab und blühender Reliquienhandel
Schon im sechsten Jahrhundert zerbrach das Reich der Burgunder und es fiel schlussendlich an das fränkische Kaiserreich von Karl dem Grossen. Nach Karls Tod 814 wurde dessen Herrschaftsgebiet mehrfach aufgeteilt, wodurch es schliesslich zu einer Neugründung des Königreichs Burgund unter Herzog Rudolf II. kam. Um 930 wurde er in der Abtei Saint-Maurice feierlich zum König gekrönt.
Das Kloster im Wallis hatte dank des Grabs der thebäischen Märtyrer für Wallfahrende eine enorme Anziehungskraft, weil es direkt an der Pilgerstrasse über den Grossen Sankt Bernhard nach Italien lag. Durch den Handel von allerlei Gebeinen und Tand – bei der Anzahl Knochen haperte es mutmasslich mit der Authentizität – gelangten viele Mauritiusreliquien in die Klöster und Kirchen halb Europas. Folglich wurde Mauritius nicht nur der Schirmherr von Burgund, sondern ab dem zehnten Jahrhundert auch Kirchenpatron des gesamten deutschen Kaiserreichs.
Burgundische Siedler und der Mauritiuskult in Saanen
Kleinere Gruppen Burgunder drangen wohl ab dem fünften Jahrhundert von Westen oder Süden her in das Saanenland ein. Sie brachten das Christentum und vielleicht Reliquien ihres Schutzheiligen Mauritius mit. Wahrscheinlich erbauten sie schon früh zu seinen Ehren eine erste Kapelle, wann genau ist unbekannt. Aufgrund von gefundenen Fundamenten unter der jetzigen Kirche in Saanen wird jedenfalls angenommen, dass es im zehnten Jahrhundert – zur Zeit der Einwanderung der Alemannen vom Simmental her – an dieser Stelle ein Gotteshaus gab. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde die dem heiligen Mauritius geweihte Kirche von Saanen (Gissinay) 1228 als Pfarrei des Bistums Lausanne. Ihr Stifter war wohl einer der Grafen von Greyerz, der seine Herrschaft in die Gebirgstäler ausweiten wollte.
Diese Kirche wurde wegen der wachsenden Bevölkerung in den Jahren 1444 bis 1447 umgebaut und vergrössert. Für die Kosten mussten die Saaner selbst aufkommen – sicherlich eine schwere Last, da sie sich 1448 auch von den letzten Bodenzinsen, Abgaben und Gewerbebeschränkungen der Greyerzer Grafen freikauften. Tragischerweise kamen bei den Arbeiten zwei Baumeister durch eine einstürzende Mauer ums Leben. Ihre Witwen mussten schliesslich sogar den angerichteten Schaden aus eigener Tasche bezahlen.
Die Einweihung konnte am 9. Juli 1447 von Bischof Stephanus von Marseille vorgenommen werden. Wie in der alten Kirche wurde der Hochaltar – neben der Dreieinigkeit sowie Maria – dem heiligen Mauritius gewidmet. Die Thebäerreliquien verwahrte man sorgsam in einem Schrein. Ausserdem ermöglichten es fromme Stiftungen zwischen 1460 und 1480, die Fresken im Kirchenchor zu finanzieren, welche – wenig überraschend – farbenfroh und lebendig das Martyrium der Thebäischen Legion nacherzählen.
Eine Walliser Verbindung und der heilige Joder in Gsteig
Neben dem westlichen Einfluss auf das Saanenland – ausgehend von Burgund, Greyerz und dem Bistum Lausanne – war im Mittelalter noch eine andere Verbindung ausschlaggebend. Seit der Römerzeit gab es über den Sanetsch einen Säumerweg ins Wallis. Für eine frühe Einwanderung von Süden spräche das entdeckte Steinfundament einer auf das Jahr 1000 datierten Kapelle in Gsteig. Belegt ist, dass um 1270 die Walliser Herren von Ayent und Raron grosse Anteile des Landes zwischen Lauenen und Gsteig besassen, dazu kam die Walliser Wispile in den Besitz der Gemeinde Savièse. Wäre es möglich, dass auch die erste Saaner Kirche über diese Verbindung begründet wurde? Man weiss es nicht.
Trotzdem ist es wohl kein Zufall, dass die 1453 gebaute Kirche von Gsteig demselben heiligen Joder, welcher die sterblichen Überreste der Thebäer nach Saint-Maurice überführt hatte, geweiht wurde. Der Gedenktag des heiligen Wallisers wurde in Gsteig noch bis ins 20. Jahrhundert jeweils am 16. August mit dem Jodermäret und einem Festmahl mit den Kühern der Walliser Wispile gefeiert. Zu alledem hängte man zur Kirchenweihe das sogenannte Joderglöcklein in den neuen Turm, das möglicherweise aus dem Vorgängerbau stammte. Noch heute wird es wegen seiner traurigen, schrägen Dissonanz ausschliesslich am Karfreitag geläutet.
Widerstand gegen die Reformation und zugedeckte «Götzenbilder»
Im November 1555 wurden die Saaner plötzlich bernische Untertanen, weil nach der Zahlungsunfähigkeit des letzten Grafen von Greyerz dessen Gebiete am Oberlauf der Saane an die Stadt Bern übergingen. In der neu gebildeten Landvogtei Saanen setzte der Berner Rat nun die Reformation mit harter Hand durch.
Der erste Landvogt Hans Rudolf von Graffenried liess durch Taglöhner die Kirchen kurzerhand ausräumen und die Altäre schleifen. Um dem «steifnackigen, rebellischen und frechen Volk» das lautere Evangelium zu verkünden, sandte der Rat den Münsterpfarrer Johann Haller. Seine erste Predigt hielt er am 5. Januar 1556 in der vollen Mauritiuskirche, am 16. Januar in Gsteig. Darauf kam es zu gewalttätigen Unruhen. Einige Familien mussten um des Glaubens willen sogar auswandern. Es gab auch Gerüchte, wonach das katholische Unterwalden und das Wallis militärisch eingreifen könnten. Nur mit Strenge – und der nötigen Milde – gelang es den Gnädigen Herren von Bern, die Reformation erfolgreich zu Ende zu bringen. Noch jahrzehntelang sollen sich aber Anhänger der alten Lehre im Turbach heimlich zur Messe getroffen haben.
50 Jahre nach der Reformation liessen die Berner auch die Fresken im Chor als «Götzenbilder» unter einer dicken Kalkschicht verschwinden. Die Jahreszahl 1604, die gross über dem Chorbogen prangt, erinnert an diese Zeit der religiösen Intoleranz. Erst über 300 Jahre später wurden die Bilder 1928 wieder freigelegt. Auch den Kirchenbrand vom 11. Juni 1940 überstanden sie wie durch ein Wunder. Sie erinnern uns in lebendiger Weise bis heute an die uralte Gründungsgeschichte dieser Anbetungsstätte, die trotz der Umwälzungen noch immer stolz den Namen seines afrikanischen Kirchenpatrons trägt und – aktueller denn je – die Menschen zu mehr Respekt und Toleranz untereinander einlädt.
Teil 1 (Sankt Petrus, Kirche Lauenen) ist am Freitag, 13. September erschienen.
Quellen:
Robert Marti-Wehren: Die Mauritiuskirche zu Saanen. Buchdruckerei E. Müller, Saanen 1920.
J.R.D. Zwahlen: Kirchliche Verhältnisse zu Saanen im Mittelalter. Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde. Band 19 (1957).
Klaus Völlmin: Auf Fels gebaut, in «Gsteig Feutersoey – früher und heute», Müller Marketing und Druck AG, Gstaad 2012.
Holger Finze-Michaelsen, Klaus Völlmin: Alte Kirchen im Simmental und Saanenland. Kopp Druck + Grafik AG, Zweisimmen, 1. Auflage 2008.
Erhard Gorys: Lexikon der Heiligen. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1997.
Joseph Guntern/Rudolf Pfister: Die Protestantisierung der Landschaft Saanen, 1555/56 (Zusammenfassung). Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Band 12 (1962).
«KIRCHENHEILIGE IM SAANENLAND»
In der dreiteiligen Serie geht es um die Kirchenheiligen unserer Region. Beleuchtet werden nicht nur ihr Ursprung, ihre Bedeutung und ihr Weg hierher, sondern auch der geschichtliche Kontext über unseren Tellerrand hinaus.
Teil 1: Sankt Petrus, Kirche Lauenen
Teil 2: Heilige Mauritius & Joder, Kirchen Saanen und Gsteig
Teil 3: Sankt Nikolaus, Kirche Rougemont und Kapälli Gstaad
DER UNTERSCHIEDLICHE UMGANG IN DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN UND EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE MIT HEILIGEN UND GEWEIHTEN GEBÄUDEN
Im römisch-katholischen Glauben kennt man - wie im Text beschrieben - die religiöse Verehrung von Heiligen und Reliquien. In katholischen Kirchen stehen Altäre, die Gotteshäuser sind geweiht.
Die evangelisch-reformierte Kirche kennt weder Heiligenverehrung noch Reliquien oder eine Weihe von Häusern und Gegenständen. In der evangelischreformierten Kirche werden ausschliesslich Menschen gesegnet. Heiligenbilder, Fresken etc. werden als bedeutende kulturelle Zeugnisse geschätzt, nicht jedoch als heilige Objekte. Der religiöse Aspekt, den diese Dinge in der katholischen Kirche haben, fehlt hier. Für die evangelisch-reformierte Kirche steht der künstlerisch-kulturelle Wert im Vordergrund (Beispiel Wiederentdeckung und Freilegung der Fresken in der Mauritiuskirche Saanen - inkl. Krönung der Maria).
PD/JOP
MAURITIUS, MAURICE ODER MORITZ – EIN MOHR?
Der Name Mauritius (französisch Maurice, deutsch Moritz) bezieht sich auf «Maure», was im Lateinischen einen dunkelhäutigen Menschen arabischer oder afrikanischer Herkunft bezeichnet und dem deutschen «Mohr» entspricht. So wurde Mauritius 1160 in einer Chronik als Befehlshaber einer «Mohrenlegion» erwähnt.
Eine um 1240 in Magdeburg erschaffene Sandsteinstatue zeigt den Heiligen als einen edlen Ritter schwarzer Hautfarbe ohne jegliche rassistischen Merkmale. Vor allem im Osten des Deutschen Reichs setzte sich die dunkelhäutige Figur in Wappen und Kirchen durch. Er wurde zum Schutzpatron für Handwerksgilden, die mit Farbe zu tun hatten, wie z.B. Färber, Tuchweber, Glasmaler usw.
Sollte Mauritius – wie einige Theologen denken – bei der Mission der heidnischen Bevölkerung Osteuropas als farbiger «Universalheiliger» besser Anklang finden? Dafür spräche, dass er in Frankreich und Burgund, die wenig an der Ostmission beteiligt waren, als weisser Heiliger dargestellt wird – so auch auf den Thebäerfresken in der Mauritiuskirche Saanen.
QUELLE: DER HEILIGE MAURITIUS (MIGRATIONS-GESCHICHTEN.DE)
VON HEILIGEN, KIRCHENPATRONEN UND IHREN RELIQUIEN.
Männer und Frauen können nach einem komplizierten Auswahlverfahren von der katholischen Kirche heiliggesprochen werden. Es handelt sich dabei um Wunder- oder Wohltäter, aber auch um grosse kirchliche Lehrer wie die zwölf Apostel. Früher waren es vor allem Märtyrer, die um des Glaubens willen starben.
Der Brauch ist, Heilige um ihre Fürsprache bei Gott zu bitten. Über ihren Gräbern baute man Kirchen, die den entsprechenden Heiligen geweiht und die wiederum ihre Kirchenpatrone oder Schutzheiligen wurden. Ihr Gedenktag wird meist bis heute jedes Jahr an einem Patronatsfest gefeiert.
Wo es kein solches Grab gab, übertrug man eine oder mehrere sogenannte Reliquien in die zu weihende Kirche und bewahrte sie in wertvollen Schreinen am Altar auf. Eine Reliquie ist ein persönlicher Gegenstand oder Knochen einer heiligen Person, die vertretend als Kirchenpatronin oder -patron im entsprechenden Gotteshaus verehrt wird. Der abgebildete kostbare Reliquienschrein des heiligen Mauritius wurde im 12. Jahrhundert in Silber gefertigt und ist im Kirchenschatz des Klosters Saint-Maurice zu sehen.
QUELLE: KLEXIKON.ZUM.DE; KIRCHE-HEUTE.CH
DER HEILIGE JODER UND DIE SATANISCHE GLOCKE
Theodul oder Theodor – im Walliserdeutschen Joder – ist der erste historisch belegte Bischof des Wallis (die abgebildete Statue befindet sich in der Altstadt von Sitten). Gemäss der Überlieferung war er ein grosser Förderer des christlichen Glaubens und nahm an verschiedenen kirchlichen Konzilen Teil. Er starb um 400 in Octodurum (Martigny), wo sich damals der Bischofssitz befand. Sein Attribut ist der glockentragende Teufel gemäss folgender Legende: Joder soll den Papst in Rom vor einer Versuchung Satans gerettet haben. Als Dank erhielt er eine Glocke, welche Satan zur Strafe auf seinem Buckel über einen Alpenpass, fortan Theodulpass genannt, ins Wallis tragen musste. Diese ursprüngliche Joderglocke zersprang in der Folge in zwölf Fragmente, die beim Guss von zwölf neuen Wetterglocken beigefügt wurden. Beim Läuten sollten durch Joders Fürsprache Unwetter abgewendet werden. Wen wunderts, dass der heilige Joder der Schirmherr der Glockenmacher, Viehzüchter und Winzer wurde? Eine der Joderglocken schaffte es 1453 sogar in den neu erbauten Turm der Gsteiger Kirche. Möglicherweise war sie von einem der Greyerzer Grafen gestiftet worden und hatte schon in einem Vorgängerbau gehangen.
QUELLE: HEILIGEDERSCHWEIZ.CH