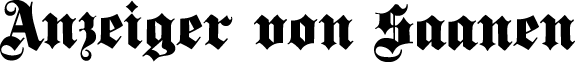Als vor 50 Jahren ein Schlechtwetter-Herbst den Landwirten das Leben schwer machte
12.07.2024 SaanenlandCHRONIK Vor 50 Jahren wurden die Landwirte im Saanenland von einem frühen Wintereinbruch überrascht, der einen ganzen Rattenschwanz an Herausforderungen mit sich brachte. Helmut Matti erinnert sich.
Jährlich begibt sich Elisabeth Müller in die Tiefen des AvS-Archivs, um die wichtigsten Ereignisse und Geschichten aus den vergangenen Jahren und aus Tausenden von Seiten herauszufiltern. Eine zeitaufwendige und enorm anspruchsvolle Aufgabe. Aus der Fülle an Informationen und Inhalten entsteht jeweils eine komprimierte Zusammenfassung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Im September kam bereits der Schnee
Die Saaner Chroniken werden jeweils neugierig und aufmerksam von unseren Leserinnen und Lesern verfolgt, so auch von Helmut Matti. Ihm ist aufgefallen, dass in der 50-jährigen Chronik der sehr schlechte Herbst nicht erwähnt war. Die Bergbauern – nicht nur im Saanenland – wurden vom frühen Wintereinbruch gegen Ende September überrascht. Es sei noch nicht alles Emd gemäht gewesen, als es am 24. September 1974 zu schneien begann und das Berggebiet eingeschneit wurde. «Oberhalb von 1300 Metern über Meer konnte das Vieh bis Ende Mai an keinem Tag mehr geweidet werden. Somit blieben die Tiere auf höheren Heimwesen acht Monate lang ununterbrochen im Stall», erinnert sich der 89-jährige Bergbauer. In tieferen Lagen habe es pro Woche zwei bis drei Tage gegeben, an denen «eher schlecht als recht» geweidet werden konnte. Ab dem 20. Oktober 1974 war im ganzen Saanenland definitiv Schluss mit dem Weidegang.
Futterkartoffeln aus dem Unterland
Gemähtes und ungemähtes Emd sei liegen geblieben und verfault, wenn es nicht vorher auf sogenannte Heuheinzen aufgehängt wurde. «Diese wurden später Etappenweise auf die Einfahrten zu den Heubühnen getragen und einzeln am ‹Schärme› und an der kurzen Sonne getrocknet», erinnert sich Matti weiter.
Es folgte ein extrem schneereicher Winter, das Tierfutter wurde rar und teuer. Bauern aus dem Unterland spendeten Futterkartoffeln und Heu für die Oberländer Berufskollegen. Sehr wahrscheinlich übernahm die Gemeinde die Verteilung dieser Gaben. Solche und ähnliche Massnahmen brachten ein wenig Linderung in der prekären Situation. «Ende Mai 1975 wurde es trotz allem wieder Frühling. Das Gras gedieh spärlich, als müsste es sich vom frühen Schneefall im Herbst erholen», weiss der altgediente Älpler zu berichten. Auf höheren Alpen habe es nur sehr kurzen Graswuchs gegeben. Zusätzlich schädigte heftiger Hagelschlag das Gebiet auf der Hohen Wispile, so dass dies für Helmut Matti der kürzeste Alpsommer von 50 Sommern wurde. Nach zehn Wochen hatte es auf der Wispile und im Länge Bode kein Gras mehr. Durchschnittlich kann dort um die 80 Tage gesömmert werden. In den letzten Jahren fand die Bergfahrt auf viele Alpen sehr früh statt. Da ist es schwer, sich vorzustellen, wie es in den späten Frühlingen der 1970er-Jahre war. 1974 wurde der Länge Bode am 28. Juni besetzt und auf den Hornberg wurde am 8. Juli gezügelt.
VERFASST VON VRENI MÜLLENER, ERGÄNZT DURCH JOCELYNE PAGE