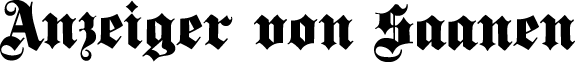Maturaarbeiten 2025: Wenn Hypothesen wackeln und Lernen beginnt
28.11.2025 SchuleDie Maturaarbeit zwingt Jugendliche dazu, ein Thema wirklich zu durchdringen – und sich von lieb gewonnenen Hypothesen zu verabschieden, wenn die Daten anders sprechen. Genau darin liegt der Wert dieser Arbeiten, wie die Präsentationen in Gstaad am vergangenen Montag einmal ...
Die Maturaarbeit zwingt Jugendliche dazu, ein Thema wirklich zu durchdringen – und sich von lieb gewonnenen Hypothesen zu verabschieden, wenn die Daten anders sprechen. Genau darin liegt der Wert dieser Arbeiten, wie die Präsentationen in Gstaad am vergangenen Montag einmal mehr zeigten.
SONJA WOLF
Auch dieses Jahr zeigte sich eine grosse thematische Spannweite: von päpstlichen Traditionen über Mikroplastik in Zellkulturen bis zur Frage, wie unbestimmte Rechtsbegriffe im Strafrecht ausgelegt werden – und dazu sportwissenschaftliche Projekte und neuropsychologische Fragestellungen. Wir hörten bei einigen Präsentationen hinein.
Motivation ist schwieriger zu messen als Muskelkraft
Elia Bach aus dem Turbach ist Leistungssportler im Skirennsport. Sein Alltag ist geprägt von Training, Krafttests und Wettkämpfen – naheliegend also, dass seine Maturaarbeit im Kraftraum entstand. Er wollte wissen, ob Motivation im Training messbare Spuren hinterlässt. Seine Hypothese: Eine Gruppe, die nach augenblicklicher Motivation trainiert, macht mehr Fortschritt als jene, die strikt nach Plan trainiert.
Dazu teilte er acht junge Männer in zwei Gruppen ein: Gruppe K (Konstanz) trainierte dreimal pro Woche an fixen Tagen. Die Gruppe M (Motivation) hingegen durfte die insgesamt zwölf Trainingseinheiten nach Lust und Laune auf vier Wochen verteilen. Die Übungen – Wandsitzen, Liegestütze, Plank und Burpees – waren für alle gleich. Vor jedem Training wurde die empfundene Motivation erhoben. Ausserdem wurde gemessen, wie stark sich die Leistung einer jeden Gruppe am Ende des Experiments verbessert hatte.
In seiner Präsentation führte Elia Bach das Publikum klar und verständlich durch Aufbau, Testverfahren und Resultate. Trotzdem blieb am Ende eine Ernüchterung: Die Daten ergaben kein eindeutiges Bild, die Unterschiede zwischen den Gruppen waren zwar da, aber nicht deutlich genug, um seine Hypothese sicher zu stützen.
In der anschliessenden Fragerunde, die ebenso wie die Präsentation 15 Minuten dauerte, griffen die Betreuenden genau das auf. Wo lagen die Schwächen? Was würde er bei einem nächsten Versuch ändern? Elia hielt fest, dass seine Hypothese «weder klar verneint noch bestätigt» werden konnte und dass die geringe Anzahl Testpersonen eine Ursache sein könnte.
So blieb ein ehrlicher Befund – und ein klarer Lerneffekt: Experimentieren ist harte Arbeit und Motivation lässt sich scheinbar nicht so einfach in Prozentzahlen pressen.
«Schliessen Sie die Augen» – Debora Lempen und die Macht der Musik
Ganz anders der Einstieg bei Debora Lempen aus St. Stephan: Bevor sie eine einzige Folie zeigte, bat sie das Publikum, die Augen zu schliessen. Dann stellte sie sich ans E-Klavier und spielte selbst die Musik ein, um die es in ihrer Arbeit ging. Erst danach erklärte sie, was sie untersuchen wollte: Wie beeinflussen Pop- und klassische Musik unseren Schlaf und unsere Emotionen?
Ihre Hypothesen knüpften an aktuelle Musik- und Schlafforschung an: Klassische Musik sollte den Schlaf verbessern und mehr positive Emotionen auslösen, Popmusik galt eher als störend – oder zumindest weniger «beruhigend».
In einem dreiwöchigen Versuch mit jungen Erwachsenen verglich sie eine Woche ohne Musik mit einer Woche klassischer Musik vor dem Einschlafen und einer Woche mit Popmusik. Gemessen wurden subjektive Schlafqualität und emotionale Reaktionen.
Wie bei Elia zeigte sich auch hier: Die Realität ist komplizierter als die Theorie. Beide Musikrichtungen verbesserten die Schlafqualität gegenüber der Woche ohne Musik, teilweise schnitt Pop sogar leicht besser ab. Bei den Emotionen ergab sich ein buntes Bild, ohne klare Siegerin unter den Musikstilen.
In der Fragerunde ging es rasch um die Grenzen des Versuchs. Die Zweitbetreuerin fragte nach möglichen Störfaktoren. Debora erklärte, die grössten Schwierigkeiten seien «die vielen externen Einflüsse» gewesen – etwa andere Musik, die die Probanden im Alltag hörten, oder die aktuelle Stimmung, die «manchmal stärker prägt als die Musik selbst».
Für ein nächstes Mal, sagte sie, würde sie strenger kontrollieren, was die Teilnehmenden über den Tag hören dürfen, und zusätzlich deren Musikvorlieben genauer erfassen.
Ihre anfänglichen Hypothesen wurden jedenfalls eher widerlegt als bestätigt. Aber genau darin liegt die Stärke der Arbeit: Sie zeigt, wie schnell man mit «steilen Thesen» an Grenzen stösst – und wie wichtig es ist, Ergebnisse vorsichtig zu interpretieren.
BETREUUNGSLEHRERIN BRANKA FLURI IM INTERVIEW
«Es geht nicht darum, eine Doktorarbeit zu schreiben»
Branka Fluri ist stellvertretende Direktorin am Gymnasium Interlaken, Abteilung Gstaad, unterrichtet Geschichte und Spanisch und betreut seit vielen Jahren Maturaarbeiten – als Erst- wie als Zweitbetreuerin. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, was hinter dem grossen Projekt «Maturaarbeit» steckt.
SONJA WOLF
Branka Fluri, die Hypothesen der Schülerinnen und Schüler sind manchmal ziemlich gewagt – von klassischer Musik, die den Schlaf der Gen Z verbessern soll, bis zur Motivation, die den Trainingserfolg steuert. Dürfen sie sich das einfach so ausdenken?
Wir lassen sie am Anfang tatsächlich relativ frei. Viele Ideen kommen aus ihrem Alltag, und das finde ich grundsätzlich gut. Aber es ist schon so, dass sich manchmal zeigt: Eine Hypothese ist schlicht nicht brauchbar. Dann versuchen wir, einzugrenzen und aus einer vagen Idee eine wissenschaftlich bearbeitbare Fragestellung zu machen. Entscheidend ist, dass am Schluss etwas entsteht, das man nicht einfach irgendwo lesen kann.
Wie läuft dieser Prozess konkret ab?
Zuerst melden sie ein Thema an. Dann erarbeiten viele eine sogenannte Disposition: Das ist wie ein kommentiertes Inhaltsverzeichnis, in dem sie festhalten, was sie in den einzelnen Kapiteln machen wollen. Später folgt die Erstfassung der Arbeit. Aber generell gilt bei uns das Holprinzip: Wer Fragen hat, muss sich melden. Wir rennen nicht hundertmal hinterher und fragen, ob noch Hilfe gebraucht wird.
Sie haben eben die Erstfassung erwähnt. Die gibt es nicht überall. Wieso haben Sie sich am Gymnasium Interlaken dafür entschieden?
Die Erstfassung wurde bei uns nach einem Plagiatsfall in einem der ersten Jahre, noch vor Eröffnung der Abteilung Gstaad, eingeführt. Eine Maturaarbeit ist ja Zulassungsbedingung für die Matur – ohne geht es nicht.
Eine Erst- und eine Zweitfassung zu korrigieren, ist zwar doppelte Arbeit für die Lehrpersonen, aber wir sind überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler beim Überarbeiten am meisten lernen. Sie sehen: «Ah, so hätte ich das auch noch machen können.» Die meisten Erstfassungen liegen irgendwo zwischen Note 3,5 und 5 – da gibt es oft einiges zu tun, auch wenn nicht alle dieses Potenzial nutzen.
Wie wird die Maturaarbeit schliesslich bewertet?
Verbindlich ist: 60 Prozent der Note entfallen auf die schriftliche Arbeit, 30 Prozent auf die mündliche Präsentation und 10 Prozent auf den Arbeitsprozess – eidgenössisch vorgegeben ist, dass diese drei Leistungen benotet werden, aber die Gewichtung bestimmt die Schule. Speziell bei uns ist, dass die Schülerinnen und Schüler selbst festlegen, wie stark Erst- und Zweitfassung innerhalb dieser 60 Prozent gewichtet werden, 30 und 40 Prozent für die Erstfassung. Viele entscheiden sich heute für 30/30.
Ist die Zweitfassung nicht automatisch die bessere?
Nein, nicht automatisch, man kann die Arbeit auch verschlimmbessern oder (fast) nicht korrigieren. Beides führt zu einer schlechteren Note.
In vielen Arbeiten – gerade in Natur- und Sozialwissenschaften – wird mit sehr kleinen Versuchspersonengruppen gearbeitet. Wie sehen Sie das?
Ganz ehrlich: Diese berühmten «sechs Befragten» oder zwei Mini-Gruppen im Vergleich gruseln mich manchmal ein bisschen. Aus so kleinen Stichproben kann man keine allgemeingültigen Schlüsse ziehen. In Geschichte ist das etwas anderes – dort kann man mit «Oral History» arbeiten, also mit einer einzelnen Lebensgeschichte, ohne Anspruch auf Repräsentativität. Aber wenn jemand seine ganze Arbeit auf Hypothesen stützt, die er mit einer Handvoll Leute «testet», ist die Aussagekraft sehr begrenzt.
Wie erleben Sie den Präsentationstag selbst?
Formell ist klar: 15 Minuten Präsentation, 15 Minuten Fragen. Wenn niemand aus dem Publikum fragt, müssen wir Lehrpersonen genug im Köcher haben, damit die Zeit sinnvoll gefüllt ist. Für mich ist dieser Frageteil besonders wichtig – dort zeigt sich, ob jemand unter Stress denken, Vermutungen anstellen und begründen kann.
Sie sind seit 20 Jahren an der Abteilung Gstaad, seit fast 30 Jahren am Gymnasium Interlaken. Wie hat sich das akademische Niveau verändert?
Ich würde sagen: Es hat sich verändert – und nicht nur zum Guten. Früher habe ich mich aufgeregt, wenn jemand nicht wusste, was eine Präposition ist. Heute frage ich das gar nicht mehr, ich erkläre es einfach. Dass grundlegende Begriffe wie «Subjekt» unbekannt sind, ist keine Ausnahme mehr. Ich glaube aber nicht, dass das nur an den Jugendlichen liegt. Lernen und sich Wissen erarbeiten gelten heute schnell als altmodisch. Alle sprechen nur noch von Kompetenzorientierung. Uns wird dann vorgeworfen, wir seien «nicht modern» – aber wir müssen die Schülerinnen und Schüler ja auch irgendwo hinbringen, nämlich an die Uni.
Und trotz all dieser Spannungsfelder – was macht Ihnen an der Maturaarbeit immer noch Freude?
Mich freut es, wenn junge Menschen sich ernsthaft mit einem Thema auseinandersetzen und wenn sie am Ende stolz auf das Geleistete sein dürfen – oder auch ehrlich sagen können: Da habe ich mich verrannt, das würde ich heute anders machen. Dann hat die Maturaarbeit ihren Zweck erfüllt. Es geht nicht darum, eine Doktorarbeit zu schreiben, sondern um einen ersten Schritt in Richtung wissenschaftliches Arbeiten – mit all seinen Umwegen.