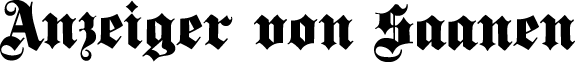«Krumme Pfote»
17.11.2023 KolumneFolge 8
Krumme Pfote, ein alter, streunender Strassenköter, begegnet auf seiner nächtlichen Suche nach Fressen einem «Menschenhund», der sich verlaufen hat, und nimmt sich seiner wider Willen an. Die Suche nach seinem Zuhause gestaltet sich schwierig. In der Dunkelheit treffen sie auf einige Jungen, die auf der Strasse leben, und sie schliessen sich ihnen an.
«Wenn die Jungen mir nur helfen könnten, meine Menschen wiederzufinden», fiepte er, während er am Randstein entlang schnüffelte.
«Sei endlich zufrieden mit dem, was du hast», bellte ich, «du scheinst das Glück, das uns zugefallen ist, dass wir auf die Jungen gestossen sind, nicht zu schätzen.»
Er schaute mich nur irritiert an und schwieg.
«Ja, ja, du bist Besseres gewöhnt. Es ist unter deiner Würde, auf der Strasse in einer Nische zu schlafen und dir von ein paar schmutzigen Jungen Brotstücke zuwerfen zu lassen. Ich kann es nicht mehr hören, lass mich in Ruhe damit!»
Der Kleine knurrte etwas Unverständliches. Eine Weile liefen wir schweigend herum. Ich zeigte ihm, wo man Essensreste finden konnte, nämlich da, wo die dicken Frauen Gemüseschalen und Knochen wegwarfen. Trotzdem waren wir unruhig und kehrten immer wieder zu dem Platz zurück, wo die Jungen arbeiteten. Zu guter Letzt blieben wir bei ihnen und wichen ihnen nicht mehr von der Seite, aus Angst sie zu verlieren.
Am Abend gingen wir noch einmal mit ihnen in das Gebäude mit den Essensständen und sie teilten ihre Mahlzeit mit uns. Wir begleiteten sie zu ihrer Schlafstelle. Da es zu regnen begonnen hatte, waren sie früher als sonst zurückgekehrt, doch sie schliefen nicht sofort. Sie drückten kleine Gefässe vor ihre Nasen, aus denen sie eine Flüssigkeit schnüffelten. Dann begannen sie seltsam zu sprechen, sie lachten laut, kniffen und stiessen sich an, bis ihre Köpfe zur Seite sanken und sie sich nicht mehr bewegten. Währenddessen jammerte der Kleine die ganze Zeit über sein Schicksal. Ich legte meinen Kopf auf die Kartons. Der Nebel hing tief. Man konnte nicht einmal mehr die Umrisse der gegenüberliegenden Gebäude erkennen. Ich war satt, es war warm und ich war doch nicht zufrieden. Ich dachte zu viel. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass ich einmal zu viel nachdenken würde. Neben mir stand eines der Gefässe. Ich begann daran zu schnüffeln. Es gefiel mir und ich schnüffelte stärker. Die Flüssigkeit benebelte meine Sinne. Alles wurde leicht und schwebend, mir schwindelte und um mich herum versank alles im Nebel und Regen.
Nachdem wir den Jungen am nächsten Morgen wieder in das Gebäude mit den Essensständen gefolgt waren und Brot bekommen hatten, gingen wir zu einem kleinen Platz oberhalb und legten uns ins Gras. Mein Kopf schmerzte, als wollte er zerplatzen. Mir war es ein Rätsel, wie die Jungen die halbe Nacht an dieser Flüssigkeit schnüffeln konnten.
«Dir scheint es heute nicht gerade gutzugehen«, meinte der Kleine.
«Mich schmerzt meint Kopf», knurrte ich. Ich hatte keinen Hunger und mehr aus Zerstreuung begann ich, am Gras zu knabbern. Es war ein herrlicher Morgen, strahlend blau, ohne eine einzige Wolke am Himmel. Der grosse Schneeberg schien im Gegenlicht noch grösser und mächtiger. Manches Mal hatte ich mir vorgestellt, wie schön es sein müsste, dort hinaufzusteigen, ins endlose Blau und Weiss, alles von oben zu betrachten, aus weiter Höhe, als würde es mich da unten nichts angehen, und mit dem Himmel zu verschmelzen. In diesen Momenten fühlte ich, dass ich alt wurde und Ruhe suchte. Schon einmal war ich aufgebrochen, um zu diesem magischen Berg mit seinen weissen Gipfeln zu gelangen, aber bald hatte ich Hunger bekommen und war entmutigt in die Stadt zurückgekehrt. Ich liess von dem Gras ab und leckte meine krumme Pfote. Der Kleine schaute dem Treiben der Menschen zu und rührte sich nicht. Plötzlich schüttelte er den Kopf. Ich wollte ihn fragen, was ihn bewegte, aber ich hatte keine Lust zu reden.
Er jedoch, ohne gefragt worden zu sein, sagte: «Eines verstehe ich nicht …»
Ich blickte ihn von unten an, legte die Stirn in Falten und stiess die Luft aus. «Was verstehst du nicht?», knurrte ich. Er blickte geradeaus, dorthin, wo die Menschen durcheinander schwirrten, aber ich sah, dass er sie nicht wahrnahm. «Ich frage mich, warum manche Menschenkinder auf der Strasse leben», sagte er.
«Du fragst dich nicht, warum du und ich auf der Strasse leben?»
«Die Menschen leben doch normalerweise in Höhlen», fuhr der Kleine verwirrt fort. «Und wo sind ihre Eltern?» Ich antwortete nicht.
«Meine Menschen haben ihre Kinder gut behandelt», sagte er. «Sie gaben ihnen Essen. Sie lachten viel und ich glaube, sie waren sehr glücklich.»
Es tat mir weh. Es schien dasselbe wie mit uns Hunden zu sein. Die hübschen und sauberen mochten sie, die hässlichen und schmutzigen verstiessen sie. Ich kannte die Menschen nicht und wusste also auch nicht, was die Menschen dachten, ob es so war oder ob noch etwas anderes dahinter steckte. Schon lange wusste ich, dass Kinder auf der Strasse lebten. Aber da ich selbst auf der Strasse lebte, hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich schloss einen Moment die Augen, schüttelte den Kopf, als könnte ich die Gedanken abwerfen. Es gelang mir nicht. Der Kleine hatte mich wieder zum Nachdenken gebracht. Ich wusste nicht, ob ich ihm dafür danken oder ihm die Gurgel durchbeissen sollte. Das Leben war einfacher, wenn man nicht nachdachte. Es schmerzte zu denken, dass alles anders sein könnte. Es schmerzte zu erkennen, dass man nicht die Kraft hatte, etwas zu verändern. Dazu brauchte man warmes Essen, nicht Fischgräten aus der Abfallgrube. Und wenn man von Gräten aus der Abfallgrube lebte, war es besser, alles zu vergessen, weil man nicht einmal die Kraft hatte, zum grossen Schneeberg hinaufzusteigen. Meine Ohren hingen auf dem Boden. Ich blickte den Kleinen an und am liebsten hätte ich ihm gesagt, er möge schweigen. Aber ich sagte es nicht.
«Und wer gibt den Kindern Milch?», fragte er.
Ich war überrascht. Nie hatte ich mich gefragt, woher die Menschenkinder Milch bekamen, aber ich wusste, dass die Mütter ihre Kleinen an die Brust drückten.
«Meine Mutter hat mir immer Milch gegeben», murmelte der Kleine, «und sie hat mich nie verlassen, ich erinnere mich genau.»
Halt endlich die Schnauze, schrie es in mir, warum quälst du mich immer weiter, warum?
STEFAN GURTNER
Folge 1: AvS vom 3. März, Folge 2: AvS vom 6. April, Folge 3: AvS vom 5. Mai, Folge 4: AvS vom 2. Juni, Folge 5: AvS vom 7. Juli, Folge 6: AvS vom 12. September; Folge 7: AvS vom 13. Oktober.
Stefan Gurtner ist im Saanenland aufgewachsen und lebt seit 1987 in Bolivien in Südamerika, wo er mit Strassenkindern arbeitet. In loser Folge schreibt er im «Anzeiger von Saanen» über das Leben mit den Jugendlichen. Wer mehr über seine Arbeit erfahren oder diese finanziell unterstützen möchte, kann sich beim Verein Tres Soles, Walter Köhli, Seeblickstrasse 29, 9037 Speicherschwendi, E-Mail: walterkoehli@ bluewin.ch erkundigen. Spenden: Tres Soles, 1660 Château-d’Oex, IBAN: CH20 0900 0000 1701 6727 4. www.tres-soles.de