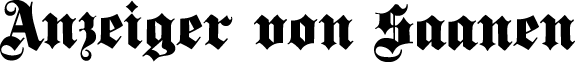Erziehung durch Malen und Maltherapie
14.11.2017 BildungSTEFAN GURTNER
Jedes Mal, wenn wir in «Tres Soles» mit älteren Kindern oder Jugendlichen zu malen beginnen, sei es in der Kartenwerkstatt oder innerhalb anderer Aktivitäten, heisst es sofort: «Ich kann aber nicht malen.»
Obwohl wir in «Tres Soles» mangels ausgebildeter Therapeuten keine eigentliche Maltherapie machen, gehört das Malen zum festen Bestandteil unseres Erziehungskonzeptes, weshalb ich mich eingehender mit dieser Art von «Seelenheilung» beschäftigt habe. Und hier muss ich gleich zu Beginn ein Missverständnis, in das auch die Kinder und Jugendlichen gern verfallen, ausräumen: Es geht nicht darum, in erster Linie ein Kunstwerk zu schaffen, sondern darum, Ideen und Gefühle auszudrücken, «um die lebendige Wirkung auf den Patienten selber», wie es der Begründer der Maltherapie, Carl Gustav Jung, ausgedrückt hat. Die Maltherapie ist relativ jung, wie eigentlich alle alternativen Bildungs- und Therapieansätze, die ich bereits vorgestellt habe. Obwohl Ärzte schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts festgestellt haben, dass sich Zeichnen und Malen vor allem auf psychisch gestörte Menschen positiv auswirkt, wurde erst um 1920 begonnen, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. 1922 veröffentlichte der Heidelberger Psychiater Hans Prinzhorn sein Buch «Die Bildnerei der Geisteskranken». Gleichzeitig arbeiteten die Maler Johannes Itten, Wassily Kandinsky und Paul Klee im Bauhaus an einem ersten kunstpädagogischen Konzept. Als der eigentliche Vater der Maltherapie muss aber, wie erwähnt, der Schweizer Psychiater und Arzt Carl Gustav Jung (1875–1961) angesehen werden. In seinem Aufsatz «Ziele der Psychotherapie» stellte er 1929 zum ersten Mal seine Methode vor. Der Satz «indem sich der Patient sozusagen selbst malt, kann er sich auch selbst gestalten» wurde schnell zum Grundprinzip der neuen Lehre. Jeder von uns ist in seinem tiefsten Innern auf eine «Gestalt» angelegt, die es herauszuarbeiten und zu formen gilt. «Die Erfahrung gab mir insofern recht, als ich des Öfteren sah, wie Menschen einfach ein Problem überwuchsen, an dem andere völlig scheiterten», schrieb Jung. «Irgendein höheres und weiteres Interesse trat in den Gesichtskreis und durch diese Erweiterung des Horizonts verlor das unlösbare Problem die Dringlichkeit.»
Jung verglich diesen Vorgang, den er «Individuationsprozess» nannte, mit einem Baum, der beim Weiterwachsen allfällige Verletzungen, die er durch Sturm und andere Einflüsse erlitten hat, einfach überwächst, bis er seine endgültige Form annimmt. Beim Menschen geht es nun darum herauszufinden, wie wir innerlich wachsen und unsere endgültige Form erreichen können. Da diese Informationen grösstenteils im Unterbewusstsein stecken, müssen wir sie hervorholen. Dies wird oft möglich durch Träume, die Informationen können aber auch in gemalten Bildern erscheinen – und hier genau setzt Jung an. «Wie die Traumsprache ist auch die Bildersprache eine Sprache des Unbewussten und sie spricht, wenn die bewusste Stimme versagt», sagte dazu die weltbekannte Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross. Mittlerweile wissen wir, dass nur etwa zehn Prozent von dem, was in unserem Gehirn vorgeht, auf der Begriffsebene stattfindet, bei den restlichen Prozent geht es um Gefühle und Bilder. Laut Jung drücken sich diese Bilder vor allem in Symbolen aus, die entschlüsselt werden müssen, um den inneren Wachstumsprozess, den er durch seine Therapie erreichen will, in Gang zu bringen, und die uns über den «bewussten Lebensentwurf» hinaus benachrichtigen sollen, was in uns sonst noch steckt. Was ist es, was wir wirklich fühlen? Was ist es, was wir wirklich wollen und nicht wollen?
Diese Therapie kann natürlich bei gesunden als auch bei kranken Menschen angewandt werden. Von heutigen Therapeuten, die Jungs Methode kontinuierlich ausgebaut haben, wird die Maltherapie vor allem bei Behandlungen von sucht- und angstkranken, depressiven und selbstmordgefährdeten Menschen empfohlen. Es werden auch Stress, Burn-out, Schizophrenie und Essstörungen genannt, die geheilt oder gemildert werden können, sowie die einfache Möglichkeit, Ängste, Trauer und Wut auszudrücken. Wenn man zum Beispiel fähig ist, Angst bildlich darzustellen, kann man sie anschauen und sich mit ihr auseinandersetzen. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass Maltherapie kein Allheilmittel ist, sondern oft mit anderen Therapieformen, etwa mit Psychotherapie oder in schweren Fällen mit einer Behandlung mit Medikamenten kombiniert werden muss, damit sie Wirkung zeigt. Jung sagt auch ganz klar, «dass die bloss darstellende Tätigkeit an und für sich ungenügend ist. Es bedarf darüber hinaus noch eines intellektuellen und emotionalen Verständnisses der Bilder, wodurch sie dem Bewussten integriert werden. Sie müssen noch einer synthetischen Deutungsarbeit unterzogen werden.»
In Bolivien gibt es leider keine oder nur ganz wenige ausgebildete Maltherapeuten, die die beschriebene Methode professionell anwenden könnten. Wir müssen uns in «Tres Soles» auf das Malen als reine Beschäftigungstherapie beschränken, ohne die Bilder im therapeutischen Gespräch interpretieren zu können. In jedem Fall geht aber vom Malen eine heilende Wirkung aus, da sind sich heute alle Therapeuten einig. Es gibt sogar einige, die die Deutungsarbeit an Bildern ablehnen: Durch das spontane Malen werden das Selbstvertrauen, die manuelle Fertigkeit für die Koordination von Auge und Hand und für die Unterscheidungsfähigkeit bei Formen und Grössen gefördert. Wie sagte doch Beuys: «Kunst ist ja Therapie.»
Stefan Gurtner ist im Saanenland aufgewachsen und lebt seit 1987 in Bolivien in Südamerika, wo er mit Strassenkindern arbeitet. In loser Folge schreibt er im «Anzeiger von Saanen» über das Leben mit den Jugendlichen. Wer mehr über seine Arbeit erfahren oder diese finanziell unterstützen möchte, der kann sich beim Verein «Tres Soles», Walter Köhli, Seeblickstrasse 29, 9037 Speicherschwendi, E-Mail: walterkoehli@ bluewin.ch erkundigen. Spenden: Tres Soles, 1660 Château-d’Oex, Kto.-Nr. 17-16727-4. www.tres-soles.de